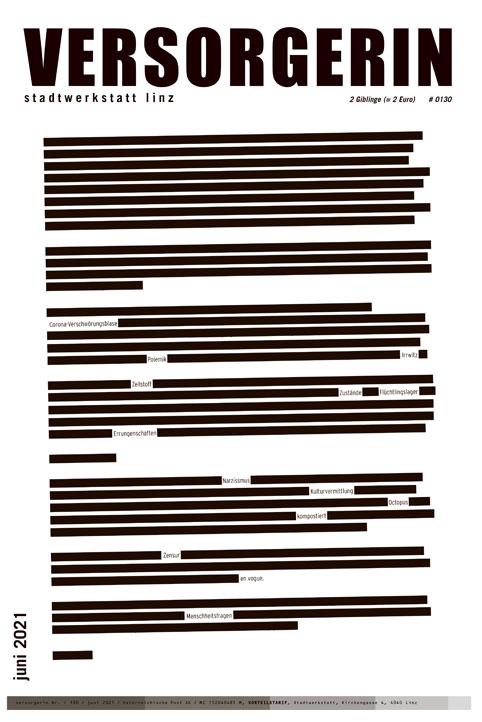Tierdokumentationen sind etwas für den Abend nach einem anstrengenden Tag. Zu jeder Bildeinstellung werden die passenden Informationen über Jahreszyklus und Verhalten des tierischen Protagonisten geliefert, als handelte es sich um die Verfilmung eines Lehrbuchs der Biologie. Das Wissen ist schon da, nun wird es unterhaltsam aufbereitet. Die Highlights des Edutainments bestehen aus Superlativen über Kraft, Ausdauer oder Lebensraum des Geschöpfs, vielleicht darf man sich auch an seiner Niedlichkeit erfreuen oder an seiner Paarung. Nicht so bei der Dokumentation My Octopus Teacher von Pippa Ehrlich, Craig Foster und James Reed. Der Film nimmt die Zuschauerin mit auf eine Entdeckungsreise, die durch keine Hypothese initiiert, sondern von ausdauernder und genauer Beobachtung vorangetrieben wird. Das Staunen über die Wunder der Natur wird hier nicht erzeugt – es wird reflektiert. Deshalb bleibt es auch nicht auf die Natur beschränkt.
Im Mittelpunkt des Films steht ein wirbelloser Kopffüßer, der den Grund flacher und halbtiefer Meereszonen bewohnt: Octopus vulgaris. Da der Oktopus – ähnlich wie seine nahen Verwandten: Schnecken oder Muscheln – seinen weichen Körper vor Angriffen schützen muss, hat er Tarnung und Wundheilung perfektioniert. Diese faszinierenden Fähigkeiten setzt der Film in Szene, doch lässt er sie geradezu unaufregend erscheinen gegenüber der Weise, wie der Oktopus durch seine Neugier und seine Spontaneität die Grenzen des Instinkts überschreitet. In seinen Kopf, besser gesagt: in sein dezentrales Nervensystem, würde man gerne hineinschauen, um zu begreifen, wie er zu Handlungen in der Lage ist, die nicht unmittelbar dem Selbsterhalt dienen. Etwa zu solchen, mit denen er einem Individuum einer anderen Artengruppe sein Vertrauen beweist. Bei dem Taucher und Dokumentarfilmer Craig Foster lenkt der Versuch, dort hineinzuschauen, den Blick vor allem auf das eigene Leben. Und zwar nicht in dem abgegriffenen Sinn, sich von
einem tierischen Multitalent an die Mangelhaftigkeit der körperlichen Ausstattung des Menschen erinnert zu sehen, oder daran, dass die Zivilisation des Homo sapiens sich zu weit von der Natur entfernt habe. Die Begegnung zwischen zweien, die sich gegenseitig als Individuen erkennen, ohne sich zu verstehen, regt das Nachdenken über das
ganz Persönliche an, insbesondere über die eigenen Beziehungen zu anderen Menschen.
In einer krisenhaften Lebensphase, so die Story, hatte Foster begonnen, bei Kapstadt in den ufernahen Algenwäldern des Südatlantik zu tauchen. Zunächst versuchte er dort nur, zur Besinnung zu kommen. Bald ist es gerade diese ziellose Bewegung, die ihn den Besonderheiten der Unterwasserwelt näher bringt, als es eine planvolle Suche wahrscheinlich vermocht hätte. Von dem Oktopusweibchen, das er dort beobachtet und bald regelmäßig aufgesucht hat, spricht er im Film nur als »sie«. Damit scheint er bedeuten zu wollen, dass es sich um eine Vertraute handelt. Aus so mancher Naturdokumentation kennt man ähnliches: Die wilde Kreatur bekommt einen putzigen Namen verpasst, als verfüge der menschliche »Entdecker« über sie, oder als könne er sich gar ihrer »Freundschaft« gewiss sein. Solche Klippen einer allzu gewollten Unmittelbarkeit umschiffen die Filmemacher*innen allerdings gezielt. Indem Foster von der Kreatur in der weiblichen dritten Person spricht, unterstreicht er, dass er sie als Expertin für ihre eigene Umwelt weiß, und dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass sie ihn daran Anteil nehmen lässt. »Sie« wird als Lehrerin geschätzt, die den Menschen beim Sehen-Lernen begleitet, nicht als Beweis dafür verklärt, dass Naturverbundenheit durch Erweckungserlebnisse zu haben sei.
Ein tierisches Individuum gewährt einem menschlichen Individuum Einblick in seine Lebensweise – diese Erzählung liest sich auch wie ein Plädoyer für eine spezifische Forschungshaltung, nämlich für das sehr genaue Hinschauen. Und dafür braucht es zuallererst Zeit. Trotz des Zwangs, verwertbare Arbeit leisten zu müssen, durchstreiften Foster und Ehrlich über anderthalb Jahre fast täglich den Algenwald, lange Zeit ohne zu wissen, ob sie dabei irgendetwas produzieren würden. Wer den kapitalistischen Wissenschaftsbetrieb kennt, weiß, was es kostet, sich dem herrschenden Effizienzdruck zu entziehen. Ist man aber bereit, sich so ausdauernd einem Gegenstand zuzuwenden, wird man damit belohnt, dessen Veränderungen zu erleben. Diese Beobachtung ist kaum spektakulär genug, um der scientific community als großer Fund serviert zu werden. Aber sie kann atemberaubend sein. Das ist es, was Foster und Co. erzählen wollen. Deshalb erfährt man auch nur mittels zusätzlicher Recherche, dass sie während ihrer Tauchgänge nebenbei acht bisher unbekannte Krabbenarten identifizierten. Weiteres Material für ihren Film fanden sie hingegen in Reflexionen über eine zweite Voraussetzung des genauen Hinschauens: Bescheidenheit. Damit ist kein vorauseilender Zweifel an der eigenen Erkenntnisfähigkeit gemeint, sondern der Versuch, dem Gegenstand nicht rein instrumentell zu begegnen. So legt die Story des Films nahe, dass man sich leichter auf die Eigenheiten eines anderen einlassen kann, wenn man sich – möglicherweise schmerzlich – gewahr geworden ist, nicht alles unter Kontrolle zu haben. Und drittens erzählt der Film davon, dass genaues Hinschauen Übungssache ist. Weil der Blick fürs Detail sich erst entwickeln muss, kann die erste überfliegende Beobachtung nicht das letzte Wort behalten. An dieser Stelle ergibt auch der Exkurs zu einer von Fosters früheren Dokumentationen über die Jäger der San in der Kalahari-Wüste schließlich Sinn. Seine Erinnerung daran, wie er die San beim Lesen der Fährten ihrer Beutetiere beobachtet hatte, mutet zu Beginn des Films noch hippie-ethnologisch an. Schließlich aber fügt sie sich in die Erzählung über das Hinschauen- lernen ein. Denn gerade ein Tier, dessen Leben ein reines Versteck-spiel ist, sieht man meistens nur, wenn man herausgefunden hat, welche Spuren es hinterlässt.
Es ist diese geballte Ladung Achtsamkeit, derentwegen My Octopus Teacher um ein Haar in eine esoterische »Eins-mit-dem-Kosmos«-Geschichte hätte abrutschen können. Das verhindern die Filmemacher*innen jedoch, indem sie den Abgleich der eigenen Beobachtungen mit vorhandenen Erkenntnissen biologischer Forschung als notwendigen Bestandteil des Naturerlebnisses behandeln. Dazu gehört auch das Eingestehen ungeklärter Fragen, anstatt die Rolle des Eingeweihten dafür auszunutzen, schön klingende Vermutungen als Gewissheiten auszugeben, wie es in vielen Tierfilmen üblich ist. Und dazu gehört das Abschweifen zu Themen, die streng genommen dem Forschungsgegenstand äußerlich sind. Gedankliche Abzweigungen und Assoziationen begleiten nun einmal jeden Forschungsprozess. Das halten die Filmemacher*innen nicht zugunsten einer vermeintlich gebotenen Stringenz aus der Erzählung heraus. Im Gegenteil ist Fosters Nachdenken über Burnout, Vaterschaft, berauschende körpereigene Botenstoffe oder das Fährtenlesen genauso Teil seiner Entdeckungsreise, wie es der Lernprozess über das maritime Ökosystem ist. Dass dieses unbedingt zu schützen ist, wird im Film übrigens nicht explizit gefordert. Offenbar war allen Beteiligten klar, dass die Einsicht sich mit jeder Szene unweigerlich aufdrängt.
Noch eine weitere Entscheidung der Filmemacher*innen sorgt dafür, dass My Octopus Teacher nicht zur verträumten »Eins-mit-dem-Kosmos«-Geschichte wird. Das Mitgefühl, das der Mensch bei der Annäherung an die Kreatur empfindet, wird zum Anlass genommen, sich der eigenen Naturhaftigkeit bewusst zu werden. Diese begründet der Film keineswegs mit holistischen Imaginationen, sondern er verortet sie in Momenten der Angst, im Nähebedürfnis und im Wissen um die eigene Verletzlichkeit. Aus dem Bewusstsein, dass die Faszination für das Tauchen einen noch lange nicht zum Unterwasserwesen macht, schöpft er sogar eine seiner fesselndsten Szenen: Während Foster den lebensbedrohlichen Angriff eines Pyjamahais auf den Oktopus beobachtet, muss er irgendwann hektisch auftauchen, weil ihm die Puste ausgeht. Als er mit frisch gefüllten Lungen wieder in der Tiefe angelangt ist, hat der Kampf der beiden Tiere eine unglaubliche Wendung genommen. Wer körperlich dafür ausgestattet ist, seinen Sauerstoff ausschließlich aus der Luft zu filtern, verpasst eben das Entscheidende, weil er im Meer allenfalls Besucher sein kann.
An diesem entscheidenden Wendepunkt stößt der Film Überlegungen über kein geringeres Thema als das Wesen der Intelligenz an. Ein Oktopus bedient sich der Geometrie, verfügt über ein hohes räumliches Vorstellungsvermögen, kann Widersacher und Beute auf immer neue Weisen täuschen, benutzt Objekte und die umgebende Landschaft als Werkzeuge, ist zu geplanten Handlungen ebenso fähig, wie zu spontanen, schöpft aus einer detaillierten Erinnerung, und wenn es nichts zu Jagen oder zu Entfliehen gibt, dann spielt er. Was uns Menschen zu intelligenten Wesen gemacht hat, ist unser Sozialleben. Durch den Austausch mit anderen, sei es in Beziehungen der Herrschaft, des Zwangs oder der Freiwilligkeit, konnten unsere Vorfahren ihre Fähigkeiten weiter entwickeln. Das unterscheidet den Weg, auf dem sich Intelligenz bei komplexen Säugetieren herausgebildet hat, grundsätzlich von demjenigen der wirbellosen Kopffüßer. Hier ist es nämlich gerade die Einsamkeit – Oktopoden sind Einzelgänger –, die es erforderlich machte, sich ein enormes Spektrum an Fertigkeiten zuzulegen. Wer Rückendeckung weder durch Artgenossen noch durch eine schützende Schale erhält, weder Sprinter noch riesiges Fressmaul ist, muss eben alle anderen überlisten. Dabei helfen einem Oktopus natürlich die großteils selbstregulierenden Pigmentzellen in seiner Haut, auch Chromatophoren genannt. Doch mindestens ebenso wichtig sind die Tricks und Kniffe, die er in den wenigen Monaten seines Lebens ausprobiert und erlernt, ohne dafür je ein Vorbild zu haben. Die Beobachtung eines Tieres, das abwägen muss, was es als nächstes tut, regt ganz andere Gedanken an, als diejenige eines Tieres, das sich aufgrund von Instinkt, körperlicher Spezialisierung und Jahreszeitenwechsel ziemlich vorhersehbar verhält. Ist eine etwa von den Meisen und Rotkehlchen vor dem Fenster entzückt, wie es übrigens auch Rosa Luxemburg war, dann kann sie es in der beruhigenden Annahme sein, dass diese hübschen Geschöpfe sich keinen Kopf machen und trotzdem klarkommen. Schaut man hingegen einem Oktopus zu, häufen sich Fragen über Fragen. Was muss da drinnen alles los sein? Was weiß er eigentlich über mich? Und ist das das selbe, was ich über mich weiß? My Octopus Teacher handelt davon, dass Selbstreflexion etwas ist, was man selbst machen muss. Man braucht dafür aber Anlässe.
Nachsatz:
Seitdem diese Rezension Anfang Februar 2021 verfasst wurde, ist My Octopus Teacher aufgrund der Oscar-Auszeichnung viel besprochen worden. Der Film erhielt zahlreiche weitere Preise, die insbesondere das Storytelling würdigen. Dagegen weisen Kritiker*innen auf die Dissonanz zwischen Kameraperspektive und Lonely-Diver-Story hin, die den Aufnahmeprozess ästhetisch verschleiere. Auf der Suche nach Beispielen dafür, dass jede Inszenierung von »Authentizität« scheitern muss, wird man tatsächlich auch in My Octopus Teacher fündig. Jedoch relativiert das nicht die erzählerische Stärke des Films. Sie besteht gerade darin, die Mensch-Natur-Beziehung als etwas Herzustellendes zu zeigen.
---------------------------------------
My Octopus Teacher, Südafrika 2020, 85 Min., Regie: Pippa Ehrlich und James Reed, Produktion: Ellen Windemuth. (Netflix Original)
---------------------------------------
Hinschauen lernen im Algenwald
Anna-Sophie Schönfelder macht sich Gedanken zum Film »My Octopus Teacher«.