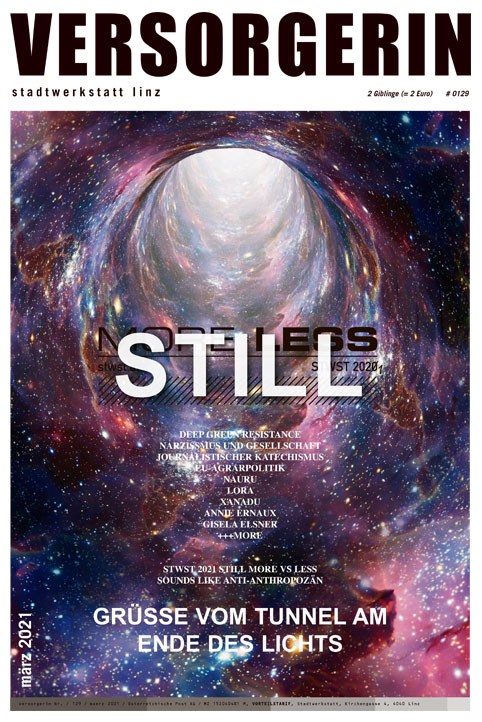Richard, wurde dir bereits der Vorwurf der „kulturellen Aneignung“ gemacht?
Nie direkt. Aber einige, die mein Buch thematisieren, kommen reflexartig auf das Thema zu sprechen. Sehr vorsichtig greift man dieses gar nicht heiße Eisen an und fragt mich, wie ich dazu stehe, und ob man den Roman oder den Umstand, dass ich, ein Bleichgesicht, ihn geschrieben habe, nicht doch vielleicht in diese Richtung kritisieren könne, und wie ich mich dazu positioniere. Interessanterweise kam das bislang noch nie von Menschen mit mehr oder minder kurdischer Abstammung. Die reagierten immer mit Neugier, Interesse und auch Dankbarkeit.
Was daran nervt: dass sehr viel Zeit mit diesem Modethema verplempert wird, welche genutzt werden könnte, interessantere Fragen zu beantworten, die den Roman betreffen und die er aufwirft.
Von diesem Vorwurf kann ich mich freisprechen, weil ich dich gleich direkt zu CA befragen werde, und zwar als jemanden, der sich seit Jahrzehnten kritisch zu verwandten Themen, vor allem zu Kulturalismus äußert, und nun zufällig, durch die Publikation eines Romans, der in Kurdistan spielt, selbst in die Schusslinie geraten könnte. Das hätte dann die eigenartige Pointe, dass – ich drücke es bewusst überspitzt aus – deine Herkunft und Abstammung zum Wertmaßstab deiner langjährigen Analysen zum Thema werden. Hast du CA nicht schon früh problematisiert?
Mich hat stets weniger die kulturelle Aneignung als die kulturalisierende Aneignung interessiert. Also die bildungsbürgerliche Gier nach kultureller Differenz, welche meistens in einem antirassistischen und antikolonialistischen Gewand daherkommt, aber diese Differenzen selbst mitkonstruiert und damit andere gesellschaftliche Widersprüche überschreibt. Eine wohlmeinende Aneignung, die dem rassistischen, meinetwegen kolonialen Denken nicht entkommt. Als 19-jähriger Kabarettist brachte ich zum Beispiel einen Sketch auf die Bühne, in der ich die Spenderniere eines regimekritischen türkischen Schriftstellers spielte, die sich in einer Talk-Show darauf freut, dem Direktor der Österreichischen Industriellenvereinigung eingepflanzt zu werden.
Ich wurde damals schon mit dem Phänomen konfrontiert, dass sich wohlhabende Österreicher einen echten Ausländer hielten. Als Freunde. Der Staranwalt einen Romamusiker, der sozialdemokratische Bankdirektor einen türkisch-kurdischen Gastarbeiter, und dann fand ich heraus, dass diese recht verdächtigen Beziehungen weit häufiger waren, als ich es mir vorgestellt hätte. Natürlich waren solche angeblichen Freundschaften alles andere als symmetrisch und zwecklos. Diese Gönner verdinglichten ihre fremden Freunde als exotische Bestätigungsdummys der eigenen Weltoffenheit und kulturellen Aufgeschlossenheit und befriedigten ihre Gier nach dem Anderen, dem Eigentlichen, Unmittelbaren, Bodenständigen, das diese Menschen angeblich verkörperten, zu, wie ich es an anderer Stelle einmal ausgedrückt habe, „Thai-Masseuren ihrer kulturellen Verspannungen“. Sie hätten aber niemals „weiße“ Proletarier zum Heurigen, ins Theater oder nachhause eingeladen. Der Prolo wird für die Eh-Leiwanden erst als der kulturell Andere zum Subjekt, das dann aber doch nichts als ein Objekt bleibt.
In einem Drehbuch für eine migrantische Komödie, das ich 2003 schrieb, hab ich eine Dinner-Party zweier Pärchen aus diesem Milieu eingebaut. Die sind mit ihren jeweiligen Ausländern unzufrieden, die einen mit ihrem Griechen, will er ihnen zu intellektuell ist, die anderen mit ihrem zu naiv-bodenständigen Kurden. So beschließen sie, ihre Ausländer einfach zu tauschen, der eine bleibt bei den Gastgebern, der andere geht mit seinen neuen Freunden heim.
Ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, dass jede künstlerische Tätigkeit in gewissem Sinne kulturelle Aneignung, dass Kultur immer ein Hybrid ist, jedes geistige Erfassen durch Aneignung passiert. Ansonsten gäbe es keine Kultur oder Zivilisation, sondern nur Autismus und totalen Provinzialismus.
Aber ich glaube, das wissen die meisten Kritiker der CA auch. Es geht den Klügeren unter ihnen um Identitätsvampirismus, um Privilegienhierarchien der Aneignung und um die Definitionsmacht. Was indianische, schwarze, balkanische Kultur ist, bestimmen wir. Was, dieser John Coltrane soll Jazz sein? Wir wollen richtigen „Jatz“. Wir wollen Peter Alexander! ... Das Problem ist nicht, dass sich der Buchhalter im Fasching als Indianer verkleidet. Selten tut er das, um First Nations People zu verspotten, sondern um sich für einen Abend sexier zu machen, als ihm das seine sonstige Existenz erlaubt. Es ginge hierbei um das klischeehafte Bild indianischer Kultur, das vermittelt wird. Dass First Nations People sich bei ihren pan-tribalen Treffen, den Pow-Wows, gar nicht anders kleiden als der Buchhalter zu Fasching, also ihr Bild von sich selbst auch bis zu einem gewissen Grad von Hollywood herleiten, ist ein extrem heikles Thema, das ich lieber von einem Apachi-Kritiker oder einer Ojibwä-Kritikerin aufgearbeitet sehen will. Denn wenn ich die Wahrheit sage, bin ich mir huronischer Martern sicher, und zwar nicht durch gekränkte First-Nations-Angehörige, sondern durch deren selbsternannte weiße Schutztruppen, die mich am Uni-Campus skalpieren werden, nicht wissend, dass das selbst eine rassistische kulturelle Aneignung ist. Die kulturelle Praxis des Skalpierens haben sich einige Native Americans übrigens von den Spaniern angeeignet. Und der Umstand, dass ein und derselbe Spanier in Amerika als Kolonisator auftritt und im geografischen und diskursiven Zentrum der Welt, in – sagen wir – Darmstadt, als Opfer rassistischer Abwertung, stellt für viele Antirassisten ein noch immer unlösbares kognitives Problem dar, das sich am besten durch moralischen Rigorismus kompensieren lässt.
So die Kritik an CA berechtigt ist, kann es nur um Machtverhältnisse gehen.
Klar. Genau diese Machtverhältnisse wollte ich gerade ansprechen.
Das wusste ich. Deshalb musste ich dir um jeden Preis zuvorkommen, damit ICH diesen Aspekt erwähne und nicht als der naive weiße liberale Onkel dastehe. Das Lob des Hybrids ist im Übrigen selbst kulturalistisch durchseucht, weil es seine Lust aus der Rassenschande bezieht, was nur funktioniert, wenn man an Rassen glaubt. Diese verdächtige Begeisterung fürs Hybrid versteht nicht, dass dieses immer der selbstverständliche Normalzustand ist, das Homogene die künstliche, ideologische Zurichtung. Und nicht umgekehrt. Die Vermischung findet nur geil, wer an das Märchen von den reinen Elementen glaubt, die sich mischen.
Der Karneval der Kulturen ist der Inbegriff bürgerlichen Bewusstseins, weil er sich die kulturelle Aneignung als gleichberechtigten Tausch einbildet. Und hierin haben die Kritiker der CA völlig recht, sie sind ein notwendiges Korrektiv, nicht nur die ehrlichen Rassisten fertigzumachen, sondern den kulturell Aufgeschlossenen den Wahn auszutreiben, ihre Verdinglichung des Migrantischen, Fremden, ihr Paternalismus, ihre Stereotypsierungen seien Awareness.
Wir haben hier nicht Platz und Zeit, über verwandte Richtungen wie Critical Whiteness und Postcolonial Theory zu reden. Bleiben wir also bei der CA, die du zu meiner Überraschung zu verteidigen scheinst, obwohl du ja durch deinen Roman „Bus nach Bingöl“ beste Aussichten hast, selbst Ziel einer solchen Kritik zu werden.
Ich bin dafür und dagegen. Dass man gegen Blackfacing und Whitewashing auftritt, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn Musiker wie Goran Bregović, um auf weißer Zigeuner zu machen, Romamusikern wie Šaban Bajramović Kompositionen und Royalties klauen, ist das ein ziemlich klarer Fall, und wenn Frankfurter Partybands mit klischeehafter Balkan-Madness mazedonischen Romabands die Gigs wegschnappen und arische Klezmerbands mit geborgter chassidischer Lebensfreude vernichtete Shtetlkultur verhöhnen, ist auch das ein Fall für den Kadi der kritischen Analyse.
Problematisch sind die Kategorien, mit denen viele CA-Kritiker operieren. Kulturelle Aneignung sagt es schon. Ihre Vorstellungen von geschlossenen Kulturen, kollektiven Identitäten mit kollektiven Besitzrechten.
Du sprichst Essenzialisierung an. Und Kulturalisierung. Die Kulturalisierung des Sozialen?
Danke. Damit entlastest du mich davon, diese elementaren Schlagwörter zu verwenden, die mich ständig daran erinnern, dass ich mich wiederhole. Aber wenn sich die Blödheiten der Welt ohne zu erröten wiederholen, muss man bei bewährten Begriffen bleiben.
Hier zeigt sich der ideologische Kern von Identitätspolitik, die pauschal abzulehnen ich selbst wiederum für eine Denkverweigerung halte. Ich habe Sozial- und Kulturanthropologie studiert, ein Studium, das Bürgerkinder magnetisch anzog. Also Menschen, die gröberer materieller Sorgen meistens enthoben waren, und sich in der Tat nichts Ungerechteres vorstellen konnten, als dass jemandem seine Kultur weggenommen wird. Sie erfassten Kolonialismus, Rassismus und globale Ungleichheit durch die Zerrbrille der kulturellen Sinnproduktion. Wer ein Dach über dem Kopf hat, für den ist das Innendesign das Nächstliegende, und er oder sie kann sich dann keinen wichtigeren politischen Kampf vorstellen, als den kulturell markierten Marginalisierten ihre Identität zurückzuerstatten. Die aber oft nur eine Projektion ist. Sie wollen dem Reservatsindianer feierlich den Schuh des Manitu zurückgeben, obwohl der nie an Manitu geglaubt hat und lieber Nike- oder Gucci-Schuhe tragen möchte.
Viele der neueren Aktivist*innen wollen ein sehr infantiles Weltbild implementieren. Kolonialismus und Rassismus werden nicht als komplizierte historisch, global und lokal variable Verhältnisse begriffen, sondern als ein auf kulturell angemalte Blöcke festgefrorenes System von geschlossenen Herrscher- und Beherrschtenkollektiven, Tätern und Opfern, folklorisiert, ethnisiert, enthistorisiert, moralisiert und wie im Nationalismus blind gegenüber internen sozialen Schichtungen.
Während der verdiente linke Antirassismus an vorderster Front noch immer gegen Essenzialismus kämpft, lassen diese identitätsbesoffenen Bürgerbubis und -mädis den Essenzialismus bei der Hintertür ins besetzte Haus hinein, weil er „Ich bin ein Opfer“ in die Gegensprechanlage gewimmert hat, und so assistieren sie dem fatalen Zerfall der Menschheit in Stämme, Gangs, Rackets, Nationen und Aberglaubensgemeinschaften. Sie meinen es gut, tragen aber dazu bei, dass es bei den Linken bald ähnlich ausschauen könnte wie bei den Rechten.
Das klingt gut, aber auch abstrakt. Heißt das eventuell, dass der Kampf gegen CA selbst rassistisch sein kann? Lass uns das anhand der am meisten strapazierten Beispiele exemplifizieren. Dreadlocks? Wo ist da der Antirassismus und wo der Rassismus?
Kritik an CA ist z. B. progressiv, wenn sie anklagt, dass von afroamerikanischen Angestellten das Abschneiden der Dreads verlangt wird, während sie bei weißen Celebritys als Weltoffenheit gefeiert werden. Solche Kritik thematisiert den unterschiedlichen Zugang zu den Gütern der Welt. Weltoffen kann nur sein, wem die Welt offensteht. Und darin zeigt sich die postkoloniale Hierarchie der Möglichkeiten. Der idealtypische privilegierte weiße Konsument hat in der Ethnoabteilung des Identitätssupermarktes unbeschränkten Zugang zu fremden Accessoires und hält sich den Fremden als Art Frischzellenlager für Stammesbewusstsein, Traditionalität und Eigentlichkeit. Ich finde Weiße, die rappen oder Blues singen, nicht schlimm, schlimmer ist es, wenn Schwarze dazu verdammt werden, nur zu rappen und Blues zu singen. Mir fiel auf, dass CA-Kritik, wenn sie von den Betroffenen selbst kommt (und nicht von ihren „weißen“ Safe-Zone-Wärter*innen), weniger der Aneignung an sich, als einer Aneignung gilt, die sie und ihre Kultur stereotypisiert.
Falsch wäre CA-Kritik, wenn die Dreadlocks als Eigentum einer angeblich kollektiven schwarzen Identität gefasst werden. Die kulturelle Aneignung begann schon, als Jamaikaner den Hairstyle der Rastafaris übernahmen, und nichts anderes ist sie, wenn sich Nigerianer und Bewohner Harlems die Haare verfilzen lassen. Sobald wir Dreads aber bei Menschen dunkler Hautfarbe als irgendwie schlüssiger und „arttypischer“ empfinden als bei Menschen käsigerer Pigmentierung oder etwa bei einem Marokkaner als natürlicher als bei einer Portugiesin, dann ist unser Erkenntnisapparat nicht nur falsch verschraubt, sondern dann haben wir ein ganz, ganz schweres Rassismusproblem. Man kann die Dreads natürlich als Symbol widerständiger Blackness deuten, was aber auch Ausrede für eine unbewusst rassifizierende Wahrnehmung sein kann. Es wäre dieselbe Art von Wahrnehmung, die die Tiroler Lederhose an einem Schweden plausibler fände als an einem Japaner.
Apropos Japaner. Würde das auch auf den Kimono zutreffen?
Die Kritik an CA hat ja nur Sinn, wenn sie die Aneignung in einer asymmetrischen Beziehung problematisiert. Ansonsten könnte man sie als spannende Hybridisierung auf Augenhöhe begrüßen. Eine schreckliche Pointe liegt aber darin, dass niemand so sehr den westlichen Überlegenheitsanspruch zementiert wie die Rasse seiner antirassistischen Kritiker*innen. Indem diese ihren oberammergau-zentrischen Fokus auf die gesamte außereuropäische Welt projizieren und deren Bewohner unterschiedlos zu genetischen Opfern, zu Objekten ihrer antikolonialen Gewissensarbeit naturalisieren. Sie sind es, die den western gaze festschreiben und – mit klassischer rassistischer Methodik – das, was nur uns am Fremden fremd erscheint, zu dessen Wesen naturalisieren. Nie kämen sie auf die Idee, das Bürger*innen einer der höchstentwickelten Industriegesellschaften der Welt, mit einer übrigens recht unaufgearbeiteten faschistischen Erblast, sich denken könnten, dass Kimono tragende Europäer endlich die Überlegenheit der japanischen Kultur eingestehen.
Ich muss hier kritisch anmerken, dass du doch ein bisschen den Eindruck erweckst, als wäre die Kritik der CA hauptsächlich das Geschäft weißer solidarischer Bürgerkinder. Doch kommt sie großteils von den Betroffenen selbst. Und ich habe dich in Verdacht, dass du dich vor ihrer Kritik drückst, indem du den Schwarzen Peter den Weißen, also den „Eh-Leiwanden“, wie du sie nennst, zuschiebst.
Volltreffer. Glatt erwischt. Du hast völlig Recht. Indem ich die negativen Aspekte der CA-Kritik den solidarischen Privilegierten zuschanze und die positiven den Betroffenen, schwatze ich mir selbst eine idealistische Lüge auf und reproduziere rassistische Zuschreibungen. Und aus der Perspektive der Betroffenen: Der rassistischen Abwertung kann ich mich als Betroffener oder Betroffene offensiv entgegenstellen, aber wie wehre ich mich gegen die kratzigen Synthetik-Samthandschuhe meiner Beschützer, die sich ihr schlechtes Gewissen an mir abstreicheln wollen und damit nicht nur meine Intimsphäre verletzen, sondern mich zu einem beschützenswerten Opfer versächlichen. Die mich dauernd empowern wollen, so als wäre ich von Natur aus schwach.
Kehren wir am Schluss zur CA in der Literatur zurück. Eigentlich hätte ich mehr auf deinen Roman fokussieren wollen. Darf nun ein weißer österreichischer Autor einen Roman über Kurden, über Kurdistan schreiben? Oder anders gesagt: Wie würdest du Anfechtungen begegnen? Ich bitte um eine möglichst polemische Antwort.
Zunächst mal: Ich schenke unermesslich mehr her, als ich mir aneigne.
Und da ich als intergalaktischer Forschungsreisender auf diesem wunderschönen Scheißplaneten notgelandet bin und seit 300 Jahren auf meine Rückführung warte, darf ich alles. Aber zugegeben, als ich, hier frisch angekommen, noch ein Materiewölkchen war, hätte ich auch Form und Identität eines Angolesen oder einer mazedonischen Romni annehmen können. Dass ich ausgerechnet in den wunderschönen Körper eines weißen alten Mannes schlüpfte und mich im Privilegienhotspot Mitteleuropa ansiedelte, ist wohl ein Eingeständnis.
Ich finde, es sollte jeder nur darüber schreiben, was er kennt. Denn wenn es auf diesem Planeten an etwas mangelt, dann sind es Familien-Sagas und Romane über das ungemein spannende Innenleben von Autor*innen. War das polemisch genug?
Meine exakte Meinung will ich mit einem Beispiel verdeutlichen. Der Münchner Anarchist Ret Marut lief 1918 seinem faschistischen Exekutionskommando davon und schrieb als B. Traven in seinem mexikanischen Exil Romane über die Unterdrückung der indigenen Bevölkerung, Bücher voll unvergleichlicher sozialer Empathie und Präzision. Sollte nach den neuen antirassistischen Rassenbestimmungsbüchern den mystischen Indioromanen eines Diplomatensohns namens – sagen wir – Gabriél José Guzmán mehr Legitimität zugestanden werden als denen des Deutschen B. Traven, dann grabe ich das Kriegsbeil aus, kralle mir die Tiroler Bergflinte oder – je nach Verfügbarkeit – ein Gurkhamesser und mache Jagd auf den völkischen Abschaum, ganz egal, ob er sich als rechts oder links versteht. Danach – versprochen – gebe ich die Waffen blankgeputzt ihren Kulturen wieder zurück.
Das Buch
Richard Schuberth, Bus nach Bingöl, Drava Verlag, Klagenfurt 2020, 280 Seiten, 21 Euro
Links
Eine Live-Aufnahme des Sketches „Nasreddin, die Spenderniere“ aus dem Jahr 1989 findet sich hier:
https://richard-schuberth.com/film___schauspiel/kabarett/
Das Theaterstück „Wie Branka sich nach oben putzte“ (2010)
https://richard-schuberth.com/buecher/wie-branka-sich-nach-oben-putzte-2012/
Trailer zu dem im Interview erwähnten Film „Die wundersamen Abenteuer des Nasreddin Kürtler“ (der als Langfilm nie zustande kam):
https://www.youtube.com/watch?v=CrXSOWBI9Qk
Vorschau zum im März erscheinenden nächsten Buch von Richard Schuberth:
Richard Schuberth
Lord Byrons letzte Fahrt
Eine Geschichte des Griechischen Unabhängigkeitskrieges
Wallstein, 2021, 540 Seiten
ca. € 29,90 (D) / ca. € 30,80 (A)