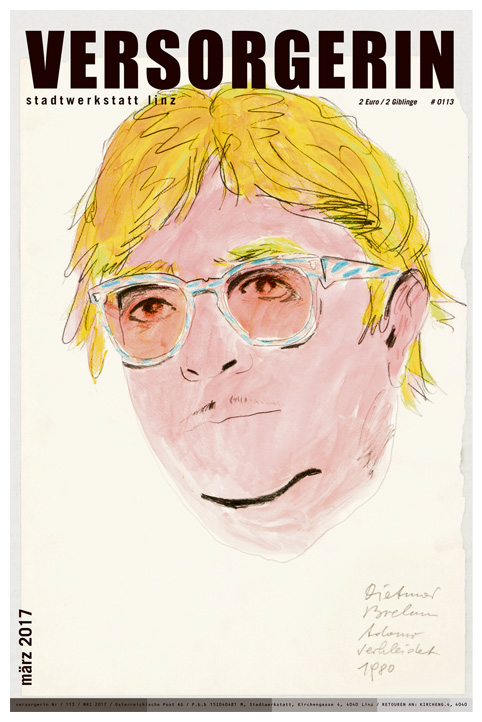Das Idyll der Ritualforschung
Symbolische Kommunikation und performative turn sind wahrlich keine neuen Phänomene. Ein Blick auf ihre Verbreitung innerhalb der Geschichtswissenschaft ist jedoch im makabren Sinne dankbar. Solch ein Blick ist zwangsläufig kursorisch, denn die Fülle der Literatur ist immens, was nicht zuletzt daher kommt, dass in diesen Kreisen schlichtweg alles als Ritual gilt oder zumindest geltend gemacht werden kann sowie Begriffsschärfe, die zwischen einem Ritual, einer Zeremonie oder Ähnlichem unterscheidet, nicht allzu verbreitet ist. Der Vorteil ist jedoch, dass man einen x-beliebigen Sammelband heranziehen kann, da es sich um die immer selbe Selbstbeweihräucherung handelt.
Gesammelter Unsinn
Ein gutes Beispiel ist die unter dem Titel »Die neue Kraft der Rituale« dokumentierte Vortragsreihe des Heidelberger Sonderforschungsbereichs »Ritualdynamik – Soziokulturelle Prozesse in historischer und kulturvergleichender Perspektive.«1 In den finsteren Zeiten der Aufklärung habe noch gegolten: »Rituale waren etwas für die anderen, die ‚Wilden‘ oder ‚Primitiven‘. Rituale galten als konservativ, die Tradition bewahrend und eben nicht fortschrittlich. Rituale galten als starr, rigide, stereotyp oder unveränderlich.«2 Erst der performative turn stellte es richtig und »man erkannte zunehmend das kreative Potenzial von Ritualen,«3 bediente sich einer »positiveren Sichtweise der Rituale«4 sowie eines »offenen Ritualbegriffs.«5 Aller bestehenden Kritik6 zum Trotz ließe »sich tatsächlich eine neue Kraft der Rituale beobachten, auch wenn sie in weiten Teilen nur die alte ist, die wir wiederentdecken. Und vielleicht (!) sehnen wir uns sogar nach dieser Kraft, weil um uns alles flüchtiger geworden ist, sehnen uns nach dem Halt, den Rituale geben oder geben sollen.«7 Indem man nun den Ethnoteil dieser Gesinnungsliteratur außen vorlässt und sich auf den historischen Aspekt konzentriert, zeigt sich eindrucksvoll, wie die antirassistisch motivierte Aversion, etwas »fremdes« Primitives einfach primitiv zu nennen, in der Konsequenz auch für die Geschichte des »Eigenen« herangezogen werden muss. Platt gesagt: Antirassismus wie auch Feminismus beinhalten »strukturell« eine Verherrlichung des Primitiven, damit aber führen sie konsequenterweise mal als expliziter Walkürenritt, mal nur implizit – zur Aufwertung des Germanentums, welche eben keineswegs nur strammen Rechtsradikalen vorbehalten ist. Denn genau in solchem vulgärhistorischen Heimatschutz muss verteidigt werden, was sonst im »Anderen« als vermeintliches Korrektiv der verdammten Zivilisation »erkannt« wurde. So schrieb Roswitha Scholz in ihrer programmatischen Schrift »Der Wert ist der Mann« radikalfeministisch: »In der mittelalterlichen Gesellschaft gab es im Patriarchat noch längere Zeit germanische ‚quasi-matriarchale‘ Relikte.«8 Ähnlich verhält es sich mittlerweile mit der »Wiederentdeckung« der germanischen Verbreitung von Wursthaaren, die man Vertretern der »kulturellen Aneignung« vorhält. Historisch ist das durchaus verbürgt, aber man outet sich endlich offen als der Fetischist der haltversprechenden Kulturangehörigkeit. Im selben obrigen Band konstatiert Gerd Theissen: »Rituale können sowohl Inszenierung von Macht als auch Inszenierung von Gegenmacht sein. Das ist kein Widerspruch: Jedes Symbol der Macht kann umfunktioniert werden zum Protest gegen die Macht, die es darstellen soll.«9 Auf die Idee, dass jene »Gegenmacht« auch nur Macht ist, dass der Protest oder Widerstand einen gewissen Rahmen eben nicht verlässt, kommt er dabei natürlich nicht. In ähnliche Richtung geht Thomas Meyer, für den es auch keinerlei Unterschied zwischen »den goldenen Karossen vergangener Monarchien«10 und den »gepanzerten Staatskarossen, de(n) Leibwächtertrauben«11 heutiger Politiker sowie keinen ernsthaften zwischen den antiken Dionysien, einem mittelalterlichen Gottesdienst oder aber dem »Ritual der täglichen Nachrichtensendung des Fernsehens«12 gibt. Oder allgemeiner: »Der Unterschied zwischen den ältesten, den alten und den neuen Zeiten besteht letztlich allein darin, dass die Rituale der Gegenwart ihre Sichtbarkeit eingebüßt haben, zumindest für uns.«13 Das Problem ist nicht der Vergleich, sondern die Gleichsetzung. Statt einer noch andauernden Vorgeschichte wird zum einen eine ewige aktiv gestaltete Geschichte suggeriert, und dabei zum anderen jede Differenz der Vorgeschichte eingeebnet. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von rituellen, auf Konsens zielenden Handlungen, also eine Geschichte von Kämpfen um Anerkennung.
Vereinzelter Unsinn
Das Verdienst der Ritualforschung besteht vor allem darin, den Bruch mit geschichtswissenschaftlichen Verfassungstheorien, wie jener Mommsens, argumentativ unterfüttert zu haben. Maßgebliche Legitimation erfuhr sie durch die Arbeiten Egon Flaigs14, der gewisse Prozesse der Meinungsbildung in der Römischen Republik herausarbeitete und die Rolle des Prestiges als symbolisches Kapital betonte sowie in der Mediävistik die Untersuchungen Hagen Kellers und Gerd Althoffs von frühmittelalterlichen Ritualen der Unterwerfung, Königserhebung, Sühne- und Buße. Erst später hat sich die Ritualforschung krampfhaft auf weitere Epochen ausgebreitet. Die »Erkenntnisse« bleiben jedoch solange eine bloße Materialsammlung wie ihre vernünftige Einordnung ausbleibt. Keineswegs geht es darum, die Spezialisierung auf Epochen oder Regionen zu kritisieren, die in Anbetracht der Global-History mehr Verteidigung verdient denn je. Aber die Vertreter beteiligen sich selbst alle an den theoretischen Meta-Diskussionen, in denen sie versuchen, die historische Theorie der Rituale zu formulieren. Symptomatisch ist hierbei die These Barbara Stollberg-Rilingers, nach der rituelle Handlungen »ein vormodernes Äquivalent für die geschriebene Verfassung der Moderne«15 seien. Die behauptete Gleichwertigkeit, welche durch das Wörtchen Äquivalent unterstellt wird, ist hierbei genau das Problem. Auch Hagen Keller schreibt in seiner kleinen Einführung über die Ottonen, dass »man Organisation und Verwaltung weitgehend ohne Schriftgebrauch bewältigte. Das hat funktioniert.«16 Zwei Seiten vorher vermerkte er noch: »Krieg gehörte fast(?) zum Alltag jener Zeit.« Sein Kollege Gerd Althoff, der zwar weiß, dass die ottonische Herrschaftspraxis, »weit hinter das Niveau der frühen Karolingerzeit zurückfiel,«17 gibt als Maß des Funktionierens an, dass die »staatlichen Gebilde […] dauerhafte Gebilde waren und die Herrschaftspraxis von den Zeitgenossen als adäquat akzeptiert wurde, auch wenn die Entwicklung zweifelsohne nicht konfliktfrei verlief.«18 Man müsse sich nur eine »uns fremde, aber durchaus vorhandene Rationalität« denken, dann könne man das Handeln der Akteure durchaus als rational beschreiben. Es ginge erst einmal darum, zu erkennen, warum die Ritualforschung gewisse Perioden bewusstlos privilegiert – sei es die Zeit der Ottonen und Merowinger gegenüber den Karolingern oder jene der römischen Republik gegenüber dem Prinzipat oder der griechischen Epoche der Polis bzw. des Hellenismus. Dann jedoch müsste man eingestehen, dass sich die favorisierten Epochen in der Regel durch Mängel und Defizite auszeichnen, dass also die Rituale höchstens ein sehr notdürftiges Substitut oder Surrogat einer Verfassung darstellen. Betrachtet man die Epochen, sind sie vor allem gekennzeichnet durch die Abwesenheit von Polizei und Verwaltung, dementsprechend durch massive persönliche Abhängigkeiten und eine ausgeprägte Schriftlosigkeit.19 Die These, dass die ottonische Herrschaftspraxis »funktionierte«, steht in einem gewissen Gegensatz zu den unzähligen Fälschungen von königlichen Verleihungsurkunden durch Adlige, mit denen sich ein eigener Forschungsstrang beschäftigt. Solche Fälschungen konnten vor allem deshalb florieren, weil es keine royalen Archive gab. Neben einer nahezu antimaterialistischen Rückkehr zur Politik der Großen zeichnet sich die Ritualforschung durch einen gleichzeitigen Fokus auf den »konsensualen« Charakter der Herrschaft aus. Das hochentwickelte Konfliktmanagement müsse nach Althoff unser Bild eines »waffenklirrenden und fehdefreudigen Mittelalters«20 relativieren. Dabei kommt es ihm keineswegs in den Sinn, dass gerade die zahlreichen Schilderungen von Versöhnungs- oder Unterwerfungsritualen, auf welche er sich bezieht, ein Beweis eben jenes Bildes sind. Die Betonung des »Konsens«, der zumindest heutzutage untrennbar mit der Freiwilligkeit verknüpft ist, verklärt die mittelalterlichen Zwänge in eine ekelhaft harmonische Idylle. Selbstverständlich waren die Fehde – oft auch innerhalb der Sippe – ebenso wie die alljährlichen Rache- und Verwüstungsfeldzüge ins Umland zentraler Bestandteil der mittelalterlichen Ordnung. Adlige »waren warlords in einem rechtsfreien Raum«21 und unter diesen war der König oder Kaiser »mehr Moderator als Monarch,«22 dabei aber immer auch selbst warlord. »Fortgesetzte Königswahl« oder »performing kingship« sind nur euphemistische Phrasen, die einerseits schlichtweg ein schwaches Königtum und mangelnde Souveränität meinen, andererseits aber das Leid der Zeit unterschlagen. Der inszenierten Herrschaft voraus ging in der Regel das militärische Kräftemessen. Als Alternative zur Unterwerfung stand der Tod bzw. dass man den Gegnern durch »Verwüstung ihres Landes, Vertreibung oder Raub ihrer Bauern Schaden zufügte und ihnen selbst sowie der Öffentlichkeit ihre Unterlegenheit vor Augen führte.«23 Althoff weiß ferner, dass man auf die Milde des Herrschers angesichts der eigenen Unterwerfung nur einmal hoffen durfte; sie »erlaubte keine Rückfälle«24, wofür es zahlreiche gewaltsame Überlieferungen gibt. Die Ritualforschung unterliegt bzw. verfällt also selbst jener Inszenierung der Herrschaft, denen noch nicht einmal die Zeitgenossen vertrauten, weshalb man sich gegenseitig im Falle von rituellen Versöhnungen Geiseln stellte. Der sogenannte »Konsens« bestand höchstens darin, dass sich Adlige – potenzielle und wertvolle Panzerreiter – nicht gegenseitig umbringen. Die Notwendigkeit dazu dürfte durch die Slawen- und Ungarneinfälle recht klarwerden. Eine Unterwerfung erfolgte also meist, nachdem nicht der andere Adlige, sondern die Bauern des Befehdeten umgebracht waren. Die Ritualforschung trägt somit selbst das Mal jener Herrschaft, welche sie zu beschreiben versucht. Zumindest historisch sind verbreitete rituelle Handlungen als Indiz der schriftlosen, auf Ehre fußenden Barbarei zu betrachten. Historiker, die sich aus Achtsamkeit jeglichen Wertungen und Urteilen verweigern, basteln mit an einer Fälschung der Geschichte. In diesem Sinne wäre die These Gerd Theissens aus dem eingangs erwähnten Band zu stärken, nach der »Rituale Abwehr von Angst« sind; »sie sind Strategien zum Terror-Management.«25
Strategien zum Terror-Management
[1] Michaels, Axel (Hg.): Die neue Kraft der Rituale. Heidelberg 2008.
[2] Michaels: Vorwort, In: Ebd. S. 5
[3] Ebd. S. 5
[4] Ebd. S. 6
[5] Ebd. S. 7
[6] Die zwei wichtigsten Kritiker der historischen Ritualforschung sind wohl Peter Dinzelbacher: Warum weint der König. sowie Philippe Buc: The dangers of ritual. Beide hat man ziemlich rasch verbannt und sich dafür des einzigen „Arguments“ bedient, das in der akademischen Welt immer zu ziehen scheint: Sie seien schlichtweg polemisch.
[7] Michaels: Vorwort. S. 8f
[8] Ähnlich argumentieren auch die radikalfeministischen Störenfriedas wie auch die rechtsradikalen Feministinnen der Gemeinschaft deutscher Frauen (GdF). Vgl: http://diestoerenfriedas.de/die-sich-wandelnde-goettin-iii-die-nordischen-goettinnen/ und http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/174172/kann-es-einen-feminismus-von-rechts-geben
[9] Gerd Theissen: Rituale des Glaubens. In: Michaels (2008). S. 15
[10] Meyer: Rituale der Politik. In: Ebd. S. 204
[11] Ebd. S. 209
[12] Ebd. S. 205
[13] Ebd. S. 201 m. Hrvh.
[14] Flaig: Ritualisierte Politik. Zeichen, Gesten und Herrschaft im Alten Rom. Göttingen 2003.
[15] Barbara Stollberg-Rilinger: Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches. München 2008, S. 14.
[16] Keller: Die Ottonen. München 2001. S. 108f m. Hrvh.
[17] Althoff: Otto III. Darmstadt 1996. S. 18
[18] Ebd. S. 19
[19] Was für Rom erst einmal wenig offensichtlich scheint. Doch bezieht es sich hier auf das erst später verschriftlichte Staatsrecht.
[20] Gerd Althoff: Genugtuung (satisfactio). Zur Eigenart gütlicher Konfliktbeilegung im Mittelalter. In: Joachim Heinzle (Hrsg.): Modernes Mittelalter. Neue Bilder einer populären Epoche. Frankfurt am Main 1994, S. 247–265, hier: S. 248
[21] Arnold Bühler: Herrschaft im Mittelalter. Stuttgart 2013. S. 31
[22] Ebd. S. 51
[23] Keller. S. 107
[24] Althoff: Otto III. S. 113
[25] In: Michaels. S. 28