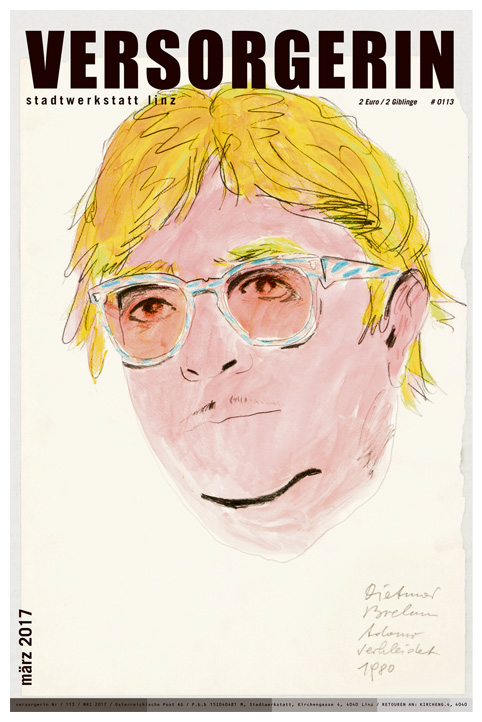Eine Konvention ist laut Wikipedia »eine (nicht notwendig festgeschriebene) Regel, die von einer Gruppe von Menschen aufgrund eines beschlossenen Konsenses eingehalten wird.« Und das Adjektiv konventionell hat (neben der Bedeutung, den gesellschaftlichen Konventionen zu entsprechen) auch die von »herkömmlich« oder »hergebracht«. Konventionell kann die Kriegsführung sein, ebenso wie Medizin oder die Landwirtschaft, aber auch die Mode. Es gab Zeiten, da wollten die Menschen alles andere als konventionell sein, es war das allerhöchste Ziel, als unkonventionell zu gelten – ob das heute noch gilt, da bin ich mir nicht so sicher.
In der Musik jedenfalls galten lange Zeit, bis weit ins 18. Jahrhundert hinein, kompositorische Konventionen, die quasi Gesetzeskraft hatten, und wenn diese überschritten wurden (was nur wenige Komponisten und nur selten wagten), war das Publikum irritiert – und nicht selten protestierten die Auftraggeber der Musik, also weltliche oder geistliche Herrscher, gegen »viele wunderliche variationes«, gegen »viele frembde, mit eingemischte Thone«, über die die Gemeinde »confundiret worden« sei, wie das Arnstädter Konsistorium seinen Kantor Johann Sebastian Bach abmahnte. Und wenn Bach, »von Natur aus ein Dissident« (Gardiner), gegen die Konventionen verstieß, etwa durch unzulässige Theatralik in seinen Leipziger Kantaten, dann geschah dies raffiniert und gewissermaßen unter der Oberfläche, und nur selten wagte sich der Komponist wirklich hervor (wie in der Wutarie in der Kantate Es reißet euch ein schrecklich Ende, BWV 90). Erst zu Haydns und Mozarts Zeiten herrschte die neue, große Freiheit, die durch Aufklärung und Französische Revolution gewonnen worden war, und der neue Mensch der Aufklärung war endlich selbstbestimmt, konnte also die Konventionen überwinden. Die Musiker dieser Zeit nutzten die neue Freiheit, weiterzugehen (Beethoven bezeichnete »allein Freiheit, weitergehn« als Zweck der »Kunstwelt wie der ganzen großen Schöpfung«), im Sinne des Fortschritts. Die alten Zöpfe wurden abgeschnitten. Das Leben und die Künste wurden an den neuen Ideen Fortschritt und Glück ausgerichtet, und das galt nicht nur für die neuen Möglichkeiten, sich auszudrücken, sondern auch für eine neue gesellschaftliche Rolle als unabhängige Musiker. Musik wurde zur Trägerin von Ideen, und diese Rolle behielt die Musik im Grunde bis heute, das war nicht mehr rückgängig zu machen, so sehr sich das Feudalsystem und später die Bourgeoisie auch mühten.
Allerdings: die »große Freiheit«, die für die Künste zu Mozarts und Beet-hovens Zeiten bestand, wurde schon wenige Jahre später von Metternichs Polizeistaat beendet. Nach dem Wiener Kongress, der »widerwärtigsten Konterrevolution der Menschheitsgeschichte« (Michael Scharang), überwachte ein brutaler Repressionsapparat Theater, Opernhäuser und Universi-täten, und das berühmte Wort Metternichs, »das Volk soll sich nicht versammeln, es soll sich zerstreuen«, führte zu einer Kultur der oberflächlichen Vergnügungen und »Zerstreuungen«, des Massengeschmacks – leichte Musik dominierte nun die Programme der Konzert- und Opernhäuser, die Unterhal-tungsmusik der Strauss-Dynastie war der Sound der Stunde. Biedermeier war eine Geisteshaltung, Schicksalsergebenheit und Untertänigkeit gegenüber den Herrschern sein Programm, Aufklärung wurde unter Strafe gestellt und der emanzipierte Bürger, Heros der Wiener Klassik, wurde bedeutungslos. Im Grunde haben wir es beim Biedermeier das erste Mal mit einem System der kulturellen Hegemonie zu tun, bei dem die Kräfte der Restauration mit allen Mitteln, unter anderem mit Zensur von Literatur und Musik, dafür sorgen, daß die Kultur des Fortschritts verunmöglicht wird und stattdessen eine leichte Unterhaltungskultur die Massen dominiert. Diese Form der Herrschaftsausübung durch kulturelle Hegemonie wurde bis in unsere Tage stets weiter verfeinert, und im gnadenlosen kapitalistischen Realismus, in dem zu leben wir gezwungen sind, haben »die äußeren Güter dieser Welt« eine »unentrinnbare Macht über den Menschen gewonnen, wie niemals zuvor in der Geschichte«, und der kulturelle »Geist« ist »aus diesem Gehäuse entwichen«, schrieb Max Weber.
Während meiner Jugendzeit in den 1970er Jahren war es ab einem gewissen Zeitpunkt, vielleicht mit 13, 14 Jahren, enorm wichtig, unkonventionell zu sein. Das machte sich vornehmlich an den Klamotten und am Haarschnitt fest – es mußten Jeans sein (die Marke war damals noch ziemlich egal), und sie mußten möglichst alt sein, am besten mit Löchern, die mühsam geflickt wurden, und zwar so, daß man sah, daß sie geflickt worden waren... Im Kleiderschrank meiner Stiefmutter hatte ich einen alten dunkelroten Strickpullover entdeckt, den ich trug, bis er auseinanderfiel. Die Haare wuchsen und wurden zunächst so lang getragen, wie es gegenüber den Eltern durchgesetzt werden konnte, und später, als deren Ge- und Verbote zunehmend unwirksam wurden, dann noch länger. Und später, mit vielleicht 17 oder 18 Jahren, hatten »wir« eine Phase, in der wir Arbeitsklamotten trugen, etwa Bäcker- oder Schreinerhosen, die es unglaublich billig gab, sie kosteten, glaube ich, 10 DM oder wenig mehr. Ehrlich gesagt bin ich froh, daß keine Beweisfotos dieser »unkonventionellen« Zeit existieren...
In dem oberbayerischen Dorf, in dem ich aufwuchs, gab es nur wenige Gleichgesinnte, und wir erkannten uns an den Klamotten und den langen Haaren, und genauso war es, wenn man trampte – auf Autobahnraststätten, ganz gleich ob in Bayern, Oberösterreich oder in der Toskana, sprach man jüngere Autofahrer mit längeren Haaren an und konnte fast sicher sein, daß sie einen mitnahmen (auch wenn man in italienischen Kleinwagen dann stundenlang elektronische Musik von Klaus Schulze hören mußte, weil der Fahrer begeistert war, daß man aus demselben Land kam wie der Moondawn-Musiker). Das Nicht-Konventionelle war eine Art Lebenseinstellung in den 1970er Jahren, man war Teil einer großen, locker verbundenen Community gegen die Konservativen, gegen jede Konvention, gegen den Status Quo. Der Uniformität dieses Styles, also seiner durchaus »alternativen« Konventionalität, war man sich nicht bewußt. Der Lackmustest der Nähe war fast immer der Musikgeschmack – denn natürlich hörte man eine bestimmte Musik, Neil Young, Dylan, Pink Floyd, die Doors, die Stones, Janis und Jimi. Die Musik verschaffte einem sozusagen den Überbau im Haus des Nicht-Konventionel-len, dessen Fundament die Klamotten waren. Und in diesem Überbau gab es interessanterweise schon damals viele Zimmer, viele Nischen (auch viele Irrwege, versteht sich), man konnte durchaus auch Bach, Mozart und Beet-hoven gut finden oder Miles und Coltrane – solange die Gemeinschaftssäle nicht in Frage gestellt wurden (also die, in denen Neil, Bob, Jim, Janis und Jimi auf ihren Sockeln standen). Und ein guter Teil meiner beginnenden Verehrung des großen Pianisten Friedrich Gulda speiste sich daraus, daß ich als jemand, der sich intensiv mit sogenannter »klassischer« Musik beschäftigte, Guldas unkonventionelle Haltung wunderbar fand. Gulda galt als enfant terrible, als jemand, der sich dem klassischen Konzertzirkus gelangweilt zu entziehen suchte, wir wußten, daß er auch Jazz spielte und sogenannte »freie Musik«, er trat unkonventionell auf, einmal soll er sogar nackt Block-flöte gespielt haben, Anzüge trug er schon lange keine mehr, dafür beschimpfte er das klassische Publikum schon mal als »stinkreaktionär«. Mitte der 1970er Jahre war das alles fast schon revolutionär, auf jeden Fall aber ein Affront gegen die Rituale des Bürgertums. Friedrich Gulda, der sein Publikum im Wiener Konzerthaus auch schon mal einer Gesichtskontrolle unterzog (denn »wenn ich die Lemuren mit dem Klavierauszug in den ersten Reihen seh’, wird mir schlecht«), hat immer wieder Zusammenhänge hergestellt und dafür geworben, daß klassische Musik keine »musikalische Heimatkunde« für die Eliten, sondern eine »musikalische Geografie der Welt« sein soll.
Es war eine vage »befreite« Zeit, befreit jedenfalls von offensichtlichen Konventionen – die Kulturindustrie war erst noch dabei, alles Rebellische, alles Unkonventionelle als eine Art Mode in die Verwertungslogik ihres Konsumkonzepts einzubauen. Letztlich waren wir (Spät-)Hippies (wie Victoria Williams in ihrem Song Summer of Drugs, den Soul Asylum zum Hit machten, mal so schön sang: eigentlich waren wir »too young to be hippies«). Und Hippies waren für die Konsumindustrie damals uninteressant. Wenige Jahre später, in Zeiten des Punk, vor allem aber des Grunge konnte es der Kulturindustrie gar nicht schnell genug gehen, jede Geste der Revolte als Mode zu verkaufen.
Und heute? Die moderne kapitalistische Gesellschaft schafft das Bedürfnis nach Erholung, Vergnügen und Zerstreuung, das sie gleichzeitig mit modernsten Methoden befriedigt, und in diesem System spielt die neo-biedermeierliche unterhaltende Musik, wie sie von der Kulturindustrie verkauft wird, eine wesentliche Rolle, weil sie ein ideales Instrument zur Sedierung der Men- schen ist, ein Mittel des bloßen Vergnügens und der Zerstreuung. Die konventionelle Musik trägt wesentlich bei zur »kulturellen Ödnis« (Mark Fisher, R.I.P.!) unserer Zeit. Nur – was ist denn heutzutage konventionelle Musik, und wie entsteht sie? Sicher, wenn wir jetzt von Helene Fischer oder Andrea Berg und all dem unerträglichen Schwachsinn der »leichten« Musik reden, wird jeder zustimmend nicken. Allerdings steckt auch im jämmerlichsten Schlager, darauf hat Georg Knepler einmal hingewiesen, »ja doch irgendein Bedürfnis nach etwas anderem. Man kann das Problem dieser Kitschmusik, der flachen Musik nicht verstehen, wenn man nicht merkt, daß sie die Stelle einnimmt, an der wirkliche Kunst sein könnte und müßte«. Viel schlimmer als die ganzen flachen Schlager dürfte die Indie-Pop-Produktion unserer Tage sein, und zwar allein schon deswegen, weil sie etwas anderes, etwas besseres, etwas unkonventionelles zu sein vorgibt. Ich denke an all die pubertäre und kitschige Trauerkloßmusik der PoiselBendzkoProsaGiesingerBouraniOerdingSchweig-höferForsterSohn und wie sie alle heißen. Diese ach so gefühlvollen jungen Männer, die Staatspop-Institutionen wie der Mannheimer Popakademie ent-schlüpfen oder von staatlichen Förderinstitutionen wie der Initiative Musik subventioniert und die in (einstigen) Kultursendungen des Staatsfernsehens begeistert propagiert werden. Ihr gemeinsamer Nenner ist: Wir sind so wahnsinnig traurig. Wir sind so super-emo! Laßt uns gemeinsam kuscheln, laßt uns in unserem wohligen Gefühl der sinnlosen Traurigkeit baden (ich weigere mich, dafür das anspruchsvolle Wort »Melancholie« zu verwenden).
Die zweieinhalb Akkorde, die dazu angeschlagen werden und die von den Produzenten bevorzugt mit viel Streichern unterlegt werden, möge sich jeder selbst vorstellen, jede musikalische Ödnis kann jederzeit noch gesteigert werden. Hier haben wir es mit einer neuen Popmusik zu tun, die gänzlich Konvention sein will und nichts anderes, eine Musik, die jederzeit ungeteilte Weltzustimmung signalisiert, gerne mit erzreaktionären Bildern spielt (die Ahnherren dieses Gefühligkeitspops sind Unheilig und Xavier Naidoo, letzterer sympathisiert bekanntlich mit den Reichsbürgern) und die Welt, die ihre Erzeuger so traurig macht, unter keinen Umständen in Frage stellt oder gar verändern will. Und gerade in ihrem vermeintlichen Unpolitisch-Sein ist diese neue Konventionsmusik sehr politisch – im kapitalistischen Realismus unserer Tage dient der Neobiedermeier der Besänftigung und Zerstreuung der Beherrschten und mithin der »Zementierung des Bestehenden« (Marcuse).
In der wöchentlichen Kulturbeilage des Berliner »Tagesspiegel« beschreiben Kulturpromis ihr »Wunschprogramm«; ganz vorn bei den jungen Kulturschaffenden: Gemütlichkeit! Am Sonntag »penne ich so lang ich kann, bestell mir was zu essen und verlasse mein Bett nicht. Schaue den ganzen Tag fern und verwandle mein Hirn in eine wabernde stumpfsinnige Masse«, bekennt der Songschreiber und Sänger der sich als durchaus rebellisch gerierenden Isolation Berlin ganz ironiefrei.
Quiet is the new loud. Spießig ist das neue »rebellisch«. Als Musiker unbedingt und uneingeschränkt super-konventionell zu sein, ist das neue unkonventionell. Anpassung regiert. Das Elend ist vollkommen.
Weltzustimmungsmusik
Berthold Seliger über Musik, die gänzlich Konvention sein will und nichts anderes.