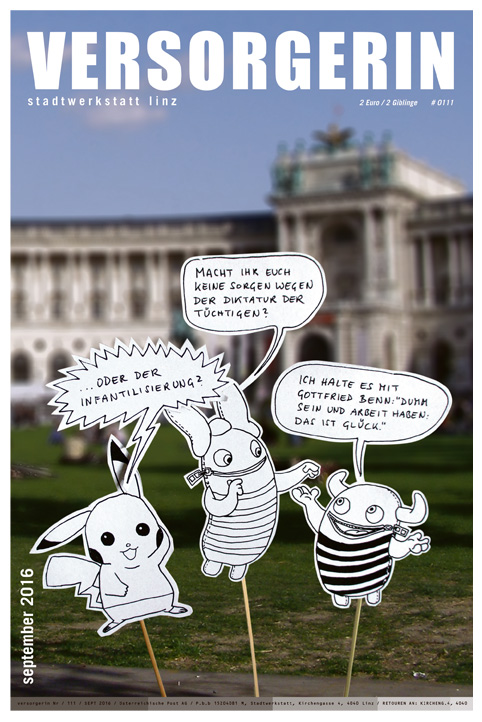„Das Ich, das biographisch erzählbar ist als Ganzheitsfigur, entsteht in der Folge von Rousseau und der englischen Romanschreiber dann weiter bei Goethe, Jean Paul bis hin zu Thomas Mann und den vielen anderen Romanautoren als genau jenes Ich, das Freud ins Zentrum seiner psychoanalytischen Konstruktionen stellt. Es beginnt sich wieder aufzulösen bei den ‚Modernen‘, bei Musil, Joyce oder Kafka; heute erscheint es als historische Erfindung des europäischen Romans.“1 (Theweleit)
„Der Mensch tut keine nur einigermaßen gesammelte Äußerung allgemeiner Natur, ohne sich ganz zu verraten, unversehens sein ganzes Ich hineinzulegen.“2(Lodovico Settembrini, Zauberberg)
[…] Das Ich, auch das psychoanalytische, ist also in erster Linie eine ästhetische „Erfindung“ und zwar in dem Sinne, dass Freud es als expliziertes über weite Strecken tatsächlich in der Literatur gefunden hat. Dass seine Leistung darin nicht aufgeht, sollte bekannt sein. […] Besonders anfällig für ein merkwürdiges Verhältnis zum Ich im eigenen Text scheinen (heutzutage) Frauen (und alle anderen Verdammten dieser Erde) zu sein, insbesondere wenn sie sich als Feministinnen (und ähnliche Opferaktivisten) verstehen. Dass Frauen dermaßen auf dem Kriegsfuß mit dem Ich stehen, scheint Freud nachträglich Recht zu geben, der ein gewissermaßen schwächeres Ich der Frauen annahm, da für sie der Ödipuskonflikt anders verlaufe. Es ist ein unangenehmer Gedanke, der sich jedoch aufdrängt, wenn man die verschiedenen weiblichen und/oder feministischen Reaktionsformen auf die eigene Emanzipation betrachtet, welche sich in der jeweiligen Literatur niederschlugen. Diese nötigen geradezu zur Frage nach einer gewissen Latenz der psychischen Emanzipation der Frau, die sich jedoch in erster Linie im Feminismus und nicht bei Frauen im Allgemeinen zeigt, was wiederum eine recht hoffnungsvolle Aussicht ist. Trotzdem kann man die einzige gelungene Metapher einer ungenannten radikalen Feministin aufgreifen und zustimmen, dass Frauen (vermutlich vor allem Feministinnen) in den meisten Fällen tatsächlich am laufenden Band nur „sinkende Schiffe erobern.“ So ist die queerfeministische Szene wohl eine der produktivsten Lyrikfraktionen der heutigen Zeit. Auch sonst haben sich dezidiert feministische Autorinnen dadurch „ausgezeichnet“, dass sie maßgeblich Relikte verfassten: Bildungsromane, Lehrstücke, in der Regel schlichtweg schlecht essayistische Literatur oder literarische Essays. […] Vor allem jene dezidierte Absage an die Trennung von Literatur und Philosophie bzw. eher Politik entstammt dem radikalen Feminismus. Die „Politik der ersten Person“, die ihnen ihre eigene Ideologie diktiert, ist die Ästhetisierung der Politik wie auch die Politisierung der Kunst. Der Unterschied ist nur ein gradueller, denn das Private unterliegt beidem - Ästhetisierung und Politisierung. So ist vor allem auch das Ich – die erste Person – einerseits politisch geformt und andererseits zum Träger der politisch-künstlerischen Aktion als Ich-Erzählerin, lyrisches Ich oder Ähnliches erkoren. Die Trennung von Werk und Autorin, welche als absolute selbst wieder Ideologie wäre, kann erst die Grundlage einer autonomen Form der Kunst sein. Die angenommene Identität hingegen endet bei ästhetischem Heideggerismus, dem sich, wie Foucault, nur noch die Frage stellt, ob das Werk den Künstler oder der Künstler das Werk geschaffen habe – Wer hat also worin seinen Ursprung?
[…] Lann Hornscheidt gilt seit der Selbsternennung zux Professx (gesprochen: zuiks Professiks) als das Enfant terrible der Berliner Universitätslandschaft. Solcherlei Neologismen bilden nun die aktuelle Crème de la Crème der feministischen Sprachanalyse und des daraus erwachsenen Aktionismus, die dezidiert auch künstlerisch sein sollen. Hornscheidt selbst scharrt dafür eine überschaubare, wenn auch äußerst aktive Gang von Querulanten um sich, die sich in der merkwürdigen Verquickung von Diskurstheorie und Konstruktivismus – der Sprachhandlung – wohl aufgenommen fühlen. Die Sprachspiele selbst sind als harmlos zu betrachten. Sie sind viel zu sektiererisch und diese „Community“ ähnelt jenem isolierten gallischen Comic-Dorf, an das die -x Endungen so aufdringlich erinnern. Der eigenen Theorie dieses Häufchens gemäß müsste man das Elend einfach verschweigen – Verzeihung: ent_nennen bzw. ent_wähnen – und das Übel würde sich von selbst auflösen. [Aber diese Exzesse sind nur die notwendige Konsequenz eines Sprachverständnis, das sich auch in weiteren Kreisen findet.] Es ist nämlich durchaus berechtigt, wenn Hornscheidt fragt: „warum schreibe ich bücher, artikel, warum halte ich vorträge, gebe ich seminare?“3 Wenn aber eine Person, die eine Professur innehat, nun von sich behauptet, dass es ihr wichtig ist, „mich nicht über andere zu stellen, mich nicht in eine position zu bringen, etwas besser zu können oder zu wissen, (das alles nicht tut), um andere zu belehren,“4 und diesen ganzen Quatsch nur zu betreiben, „um mich anwesend zu machen, um mich zu kommunizieren, (…), weil ich etwas sagen will, weil ich raum einnehmen will,“5 deutet dies auf einen maßlos rationalisierten Narzissmus. Wie bedeutend diese Anwesenheit des Ichs ist, zeigt ein kleiner Ausschnitt aus einem recht neuen Interview: „ZEIT: Sind Sie ein glücklicher Mensch? Hornscheidt: Ja. Ich habe gerade meinen 50. Geburtstag gefeiert, und ich habe das gute Gefühl: Wenn ich jetzt sterben würde – ich bin wirklich anwesend gewesen.“6 Jeder Vortrag, jedes Buch und jedes Interview dienen also schlichtweg als eine Reviermarkierung, als ein überall hinterlassenes „Lann war hier.“ […] Motiv und Programmatik des hornscheidtschen Schreibens sind nach eigener Aussage neben diesem raumeinnehmenden Ich vor allem auch die Wut, zusammengenommen also auf den ersten Blick ein wütendes, ein dauerempörtes Ich, dessen „Urteile“ nur durch Unlust motiviert sind. Schon in diesem Sinne sind sie bloße Sinnes- statt Reflexionsurteile. Auch die kategorische Kleinschreibung wird gerade damit begründet, dass dadurch das assoziative Schreiben besser fließe. Empfohlen (es ist immerhin ein „lern-, denk-und handlungsbuch“) wird nun, so zu schreiben, dass „das eigene ich anwesend sei, da es wichtig sei für das, was geschrieben wird.“7 Da dieses >Ich< im Kanon der Irrationalität jedoch ein arg vorbelastetes ist, müsse man erst einmal fragen: „gibt es ein klares und klar umgrenztes >ich<? (Von Bedeutung sei doch vielmehr) eine infragestellung der normen, was >ich< ist,“8 und somit auch die Setzung eines neuen Ichs. Da dieses eine Ich aber immer weiß, männlich etc pp. konstituiert („konstruiert“) sei, müsse dagegen die „idee unterschiedlicher >ichs<“9 gesetzt werden, denn dieses „vielstimmige schreiben“ könne erst „das stehenlassen von unterschiedlichkeiten“10 betonen, schließlich kann man eine universelle Wahrheit partout nicht akzeptieren. […] Solche >Ichs< sind die verschiedenen Sprechorte, von denen im Rahmen der Intersektionalität jede Person mehrere besitzen kann, wobei das (oder ein) Recht zu sprechen jeweils aus einer erfahrenen Diskriminierung erwachse – umso schlimmer man dran sei, umso lauter dürfe bzw. müsse man also brüllen. Solch ein Segment-Ich (Theweleit) „nannte man früher „Spaltung“ – zur Zeit Freuds bezeichnet Spaltung noch eine Pathologie – etwas in Richtung Schizophrenie. Heute lebt das Segment-Ich solche Spaltungen ohne Pathologie.“11 Theweleit beschriebt ferner die einzige Einschränkung, der solch ein fragmentiertes Ich heute von gesellschaftlicher Seite unterliegt: „Es muss in Enklaven passieren, in jeweils eigens errichteten gesellschaftlichen Spezialräumen, die nicht jedem zugänglich sind. Man könnte auch sagen: in Parzellen oder Milieus, Communities, Clubs oder Privatstaaten.“12 Die Ichs repräsentieren also unvermittelt die Communites, denen man sich zugehörig fühlt. Das fragmentarische Ich bildetet sich aus verschiedenen Repräsentanten des nie integrierten Über-Ichs und Ich-Ideals – das Ich selbst ist nur noch Resonanzkörper der verschiedenen Ansprüche und damit im schlimmsten Sinne objektiv und unpersönlich. […] Demnach resultiert auch die Ich-Spaltung eigentlich aus einer Spaltung des Über-Ichs und Ich-Ideals, denn es ist eine künstliche Spaltung, wie sie auch in heutigen Therapien fatalerweise immer mehr zur gängigen Praxis gehört, und die durchaus eine individuell begründete Disposition voraussetzt, welche heutzutage aber als recht allgemein verbreitet angenommen werden muss. Im Falle von Hornscheidt und verwandten Denkungsarten, also diese zu Ideologien geformten Borderline-Störungen, ist diese pathologische Beschädigung in eine bestimmte hierarchische Form gegossen. Es handelt sich hierbei um eine aktive Verkehrung ins Gegenteil der angeblichen gesellschaftlichen Realität – eine Wendung vom scheinbar Passiven zum Aktiven. In politaktivistischen Kreisen jedoch muss sich eine gewisse Institution herausbilden, da andernfalls aufgrund des mangelnden Reizschutzes das ganze Gebilde, das sich Mensch nennt, psychisch zusammenbrechen würde. Die Aktivisten vollziehen strenggenommen eine Spaltung in verschiedene Über-Ichs und Ich-Ideale, die Léon Wurmser für schwerste Formen der Neurosen mit unbestimmtem Übergang zur Psychose annimmt. Der Führer ist hier ein geteilter, deshalb ist diese psychische Konstitution aber nicht weniger faschistisch bzw. autoritär. Es handelt sich vielmehr um jeweils absolute, aber sich widerstrebende Über-Ich-Forderungen, zu denen sich zu allem Übel ebensolche auseinanderdriftenden Strebungen in Richtung verschiedener, sich oftmals entgegenstehender Ich-Ideale gesellen. Für all diese müssen zwangsläufig Personifikationen gefunden werden, die hier dem ursprünglichen Wortlaut gemäß tatsächlich nur Maskenfunktion haben. Weibliche und/oder schwarze und/oder irgendwie anders diskriminierte Idole, werden an die Stelle der weißen etc. Vaterfigur gesetzt. So entsteht eine Kastengesellschaft im Kopf, in der unzählige Tabus herrschen. Unberührbar zu sein hat hier mehrere Funktionen - die weißen, heterosexuellen... Männer sind hier so unzitierbar, wie auf der anderen Seite unkritisierbar die schwarzen Frauen/Lesben/Transsexuellen. Solcher Art (selbstgeschaffenen) Loyalitätskonflikte (Opferkonkurrenzen) sind nach Léon Wurmser vor allem geprägt durch „Schutzfiguren“ - im mehrfachen Sinne: Figuren, die man in Schutz nehmen muss, solche, vor denen man Schutz benötigt und jene, die einem Schutz gewähren sollen. All diese Konstellationen übersteigen jede normale Objektbeziehung – sowohl die militante Abwertung der scheinbar aggressiven und bedrohlichen Objekte, welche als deutlich überwiegend wahrgenommen werden, was auf eine schwere Form von Paranoia hinweist, als auch die Idealisierung bis in zur projektiven Identifikation der komplett unrealistisch überhöhten und oftmals unerreichbaren Idealfiguren. […]
Der Fragment- oder Körperpanzer, den Theweleit den soldatischen Männern attestierte, und der das Es als eine Art „sekundäres“ oder künstliches „Ich“ zusammenhalten soll, erlebt heute seine neue, aber diskursive Blüte. Wie im militärischen Drill zählt auch im aktivistisch-akademischen der Gehorsam, die Autorität und der Korpsgeist. […] Vor allem bezieht sich jedoch alles auf diesen entleiblichten Körper(panzer) – in diesem Fall auf seine Funktion im Rahmen der „Sichtbarkeit.“ Selbst beispielsweise die sonst unsichtbare Sexualität, das Begehren, soll „sichtbar“ werden, muss also präsentiert werden. Der Körper fungiert somit zugleich als schützende Uniform. Es ist jene Hülle in der das verleugnete Es, als Wut, brodelt, und die Sicherheit in Form einer Gewissheit über den Rang innerhalb dieses Bündnisses von Rackets verleiht. […] Rationalisiert bzw. ideologisiert ergibt sich daraus ein Konglomerat aus verschiedenen Schulden und Ansprüchen, die aus Privilegien oder Diskriminierungen erwachsen, und die jede Person auf der eigenen Haut mit sich herumträgt – jeder Person kann somit nach einem Blick die ihr entsprechende (Ab-)Rechnung serviert werden. Das Lustprinzip wird, statt durch ein Realitätsprinzip ersetzt zu werden, um ein Schuldprinzip ergänzt, das mit ersterem in stetigem Widerstreit stehen muss, weil es seine Strebungen nicht absichert, und die Schuldgefühle somit nur noch verstärken kann. Eben solche Ichlosigkeit kommt zum Ausdruck in der Durchstreichen der Person durch die Verwendung des X. Jenes Symbol, das sowohl als die mathematische Unbekannte als auch das statt einer Unterschrift verwendete Zeichen eines Analphabeten bekannt war, fand beispielsweise in der widerlichen Nation of Islam Verwendung, um damit die Ablegung des „Sklavennamen“ zu verdeutlichen und zu manifestieren. Es geht also um das Durchstreichen jeder individuellen Geschichte, die ein Ich ja erst herausbilden könnte. Das Ich wird zum Panzer, zum Selbst, und Geschichte wird endgültig zur Technik. Die schon an sich unerträgliche Frage „Wer bin ich, und wenn ja wieviele?“ (irgend solch ein Modephilosoph) wird hier also verdinglicht zum „Was bin ich, und wenn ja wieviele?“
[…] [Hier seien fragmentarisch nur diejenigen Autorinnen herausgegriffen, die gleichzeitig Bezugspunkte von Hornscheidt bilden.]
[…] Jeanette Wintersons Erzählung „Die Last der Welt“ beginnt nach wenigen Zeilen folgendermaßen: „Diese persönliche Geschichte ist in der ersten Person geschrieben. (…) Selbstentblößung und Verwundbarkeit halte ich für integrale Bestandteile des Schreibens. (Alles andere) verweist auf eine schreckliche Angst vor Innerlichkeit.“13 Sie, die an anderer Stelle ihr „Ich“ gefunden hatte, während sie eingesperrt im dunklen Keller verharrte, und diesen Vorgang – diese Zeit zum Denken – noch halbwegs begrüßt, beweist nun allein durch die Wahl des eigenen Lieblingsheroen, dass es sich bei jener „Selbstliebe“, die das Ich ausmache, sehr wohl um „diese Ich-ich-ich-Art“14 handelt, welche in ihrem dezidiert autobiographischen Roman noch geleugnet wurde. Dieses Ich wird jedoch durch die Identifikation mit dem mythologischen Atlas nicht nur zum Mittelpunkt, sondern sogar zur einzigen Trägerin der ganzen Welt erhoben. Dass solche Figurenmodelation wiederum eine jener berüchtigten Verkehrungen darstellt – hier von der kompletten Überflüssigkeit der Einzelnen zur Hauptverantwortlichen für den Lauf der Welt; „Ich bin der Kosmos – ich bin alles, was es gibt“15, dürfte mittlerweile kaum noch überraschen, zu oft wiederholte sich das Bild bisher. Bedeutsam ist hier vielmehr die oben schon vermerkte künstliche Spaltung des Ichs – diesmal in einer wirklich therapeutischen Konnotation: „Das verrückte Wesen in mir war ein verlorenes Kind. Es war bereit, sich eine Geschichte erzählen zu lassen. Mein erwachsenes Ich musste sie ihm erzählen.“16 Jenes „verlorene wütende gehässige Kind, das allein im tiefsten Sumpf lebt,“17 trifft sich vorzüglich mit der gerade in feministischen Kreis sehr beliebten und verbreiteten Vorstellung des „Inneren Kindes“. Allzu offensichtlich repräsentiert diese Figur einen verleugneten oder abgewehrten Gebärwunsch und die damit zusammenhängenden Regressionen auf infantile Niveaustufen der Psychogenese. Darüber hinaus handelt es sich hierbei um eine gewollte und gezielte Desintegration psychischer Instanzen in Form einer Ich-Spaltung in Kind-Ich, Erwachsenen-Ich, Eltern-Ich, und falls „nötig“ weitere psychische Charaktermasken, die ergänzt werden um „sichere Orte“ und ominöse „helfende Wesen“ bis hin zum inneren Teenager, der noch einmal richtig auf den Putz hauen darf. In der „Arbeit“ mit dem Inneren Kind – wobei nie ganz klar ist, ob das nun psychische Kinderarbeit oder einfach Selbstbetreuung ist – gilt jegliches Schreiben als Verhaltenstherapie; es gerinnt zum therapeutischen Schreiben, woran auch die von Lann Hornscheidt vorgeschlagenen „Schreibübungen“ gemahnen. Aus triebökonomischer Sicht ist dies eine recht gute Legitimation, alle Hemmungen fallen zu lassen. Um das innere Kind-Ich zu verteidigen, sind alle Mittel gerechtfertigt, immerhin nimmt man sich selbst gegenüber die Rolle des Elternteils bzw. eines Muttertieres ein. Das Grundbedürfnis dieses Kind-Ichs bestehe vor allem in Anerkennung. Hier zeigt sich wiederholt die Einforderung des „Beachte mich!“ als eine der Grundmotivationen weiblichen und feministischen Schreibens. Als wüsste man dies bis dahin nicht längst, da es förmlich aus jeder Formulierung ihrer Texte spricht, erfährt man abschließend dennoch: „Ich bin kein Freudianer.“18
[…] Gerade weil sie dies nie mit solch trotzigem Stolz von sich behaupten würde, ist Anne Webers „Erste Person“19 dagegen ein wahrer Genuss. Dieses Urteil trägt vermutlich wirklich nur im direkten Vergleich, denn das Buch weist zahlreiche Schwächen auf, wie zum Beispiel das permanente Adressieren der Leserschaft, was daher komme, dass sie „auf dem Rücken den Leser trage, jene dritte Person, die (ihr) zuweilen entgleitet, und zur zweiten Person wird.“20 Immerhin weiß sie von manchen ihrer Fehltritte, aber auch hier wiederholt sich der Atlas-Komplex: „Wie Atlas, aber ohne dessen athletische Konstitution zu besitzen, trug ich die Welt auf meinen Schultern.“21 Zwar findet sich keine Spur von dem Muskelpanzer, den Allmachtsphantasien tut dies jedoch keinen Abbruch. So stellt sie die berechtigte Frage („Erfindet man nicht ohnehin nur Figuren, die einem gleichen?“) nur, um in völliger Verkennung der künstlerischen Abspaltung von Ich-Anteilen zu postulieren: „Ich werde niemanden erfinden, denn ich berge die Welt.“22 Sie stellt dann auch fest, dass in „Schreiben“ sowohl „reiben“ als auch „Schrei“ steckt, lässt dies aber im Gegensatz zu den penetranten hornscheidtschen Silbentrennungsübungen qua Unterstrich augenblicklich wieder fallen, wie es solch einem Einfall nun einmal angemessen ist. Noch einmal: es ist kein wirklich gutes Buch, Tiere haben hier Menschlichkeit und Stolz bewahrt, viel zu oft präsentiert sich alles unglaublich wulstig, es liest sich über weite Strecken wie ein sehr schlechter Abklatsch der französischen Moderne; um den Versuch einer „Dekonstruktion“ hingegen, wie ein Kritiker meinte, handelt es sich nun wirklich nicht, strenggenommen noch nicht einmal um eine „Reflexion“, wie es der Klappentext vermeint. Die Stärke liegt hier erstaunlicherweise gerade im Assoziativen, da somit auch der größte Quatsch in den meisten Fällen schnell wieder aus der Perspektive verschwindet. Für den assoziativen Charakter sorgt nicht zuletzt der Aufbau als philosophisch-schamanische Seelenreise. Der notwendige Trugschluss ist jedoch – und damit bildet sie das andere Extrem -, dass sich die „erste Person“, das Ich, unter den „Masken, Haut- und Gedächtnisschichten, (unter dem) leichten Schleier der Tränen und de(m) Blutvorhang“23 befinde. Aber selbst diese durchaus dominante Innerlichkeitsvorstellung des Ichs, wird irgendwann hinterfragt: „In der Tiefe tauchend trifft mein Blick auf eine Wolkenschicht, die mir irgendetwas verbirgt, aber was?“24 Das angeblich authentische Ich ist – bleibt man bei dem Instanzenmodell - schlichtweg das Es, dem sie partiell, aber scheinbar bewusstlos zur Darstellung verhilft. Sie nähert sich dem Unbewussten („dieser Kreatur, die in mir wohnt und mir manchmal Zeichen gibt“25) auf eine durchaus kunstvolle Weise, nur weiß man nie so recht, ob ihr bewusst ist, was sie macht. Die Beschreibung dieses „Wesens, das mich zum Verbrechen anstiftet,“26 ist ferner weit ab jeglichen Unschuldsgestus, der sonst so zentral in feministischer Literatur ist. Indem sie das Ich ungewollt und bewusstlos verfehlt, landet sie zumindest nicht bei jenem feministischen Polit-Ich, das für gewöhnlich in einer Reinheit erscheint, die man eher steril nennen müsste: „Die erste Person ist über alle Maßen eitel; noch ihre Mängel liebt und hegt sie wie rachitische Kinder.“27 Fern liegt ihr jegliche Scham beim Blick auf ihr Unbewusstes. Die zahllosen phantasierten Morde und Vergewaltigungen, die immer an Nahestehenden vollzogen werden, lösen selbst in ihrer Erzählung kein einziges Schuld- oder Schamgefühl aus, denn sie weiß genau, dass hier keine Verantwortlichkeit herrscht. […] Die Wahrheit versteckt sich in den – betrachtet man das gesamte Werk zu wenigen – gelungenen Anspielungen, und lässt sich selbst dort oft nur negativ fassen. So ist die Einsamkeit ein „Mantel“, der „zur zweiten Haut“28 oder gar zum „Panzer“29 wird. Gelungen ist hingegen die Darstellung des (eigenen) Narzissmus mit all den Motiven wie Hunger, Dunkelheit, Schlaf und Tod. Selbst der nervige Einsamkeitspathos, die Sexualfeindschaft zugunsten des Hungers und sogar das Selbstbild als Taucher sind in diesem Sinne durchaus konsequent verwendet. Richtig an der Schrift ist vor allem die implizite Erkenntnis, dass das Ich aus narzisstischem Standpunkt eine Anmaßung darstellt. Zugutehalten kann man Weber außerdem, dass sie die Realität als Realität, wenn auch als leidvolle, anerkennt: „Im täglichen Leben bin ich ein zum Singulär verurteiltes Wesen.“30 Dieses Urteil ist ihr jedoch ein gesamtmenschliches und die Allgemeinheit ihres Schicksal lässt dieses in ihren Augen nicht mehr tragisch, sondern nur noch traurig erscheinen. Damit versagt sie sich zumindest hier der sonstigen Selbsterhöhung. […] Nur das „Ich“ gilt ihr als Atlas, besser: Nur als „Ich“ fühlt sie sich selbst als Atlas, wenn sie auch zugibt, nur ein äußerst schwacher Abklatsch zu sein. Und obwohl sie verkennt, dass die Welt zu ertragen etwas anderes ist, als sie gleich ganz zu tragen, bezeichnet diese Schwäche das schwache Ich. Endlich scheint es ihr vor allem darum zu gehen, irgendeinen unbestimmten Ballast abzuwerfen. Auf ihrer regressiven Reise trifft sie schließlich auf die Sprache als Barriere des Unbewussten; „Die Sprache wäre bestimmt der erste über Bord geworfene Ballast.“31 Eben dieser Satz trifft das Verhältnis von Sprache und Unbewusstem wesentlich besser als es jede feministische Psychoanalyse und Sprachpolitik es jemals vermochte. Wie die Zeit ist ihr die Sprache etwas Überindividuelles. Die Erfüllung ihres Wunsches, zum Kreatürlichen zurückzukehren, wird als Phantasie erkannt und nicht in individueller Revolte versucht. […] Zumindest am Ende ihrer Reise gelangt sie endlich zu der späten, aber richtigen Erkenntnis: „Auch die Tiefe war Illusion,“32 denn „die erste Person ist als einzige hohl.“33 Aus dieser für sie als Schock erfahrenen Einsicht, resultiert schließlich die komplette Zuwendung zum Es. Diesem kommt zugute, dass es nicht ansprechbar ist (als Du), und von Freud nicht ohne Grund grammatikalisch durch eine dritte und dabei die geschlechtslose bzw vorgeschlechtliche „Person“ bezeichnet wurde. […] Ihr Programm heißt schließlich äußerste, aber wenigstens individuelle Regression. Man beobachtet als Leserin einen Narzissmus in seiner drastischsten Konsequenz: das Obsiegen des Todestriebs. [...] Letztlich zeigt sich hier also nur eine literarische Kapitulation vor dem Leben. Die Befreiung vom Ich, die mit seinem Finden identisch sei, wird mit den suizidalen Worten verkündet: „Ich bin tot.“34 Das sich im Tode, dem scheinbar einzig authentischen Ausgang – auflösende weibliche Ich war hingegen das Lieblingsmotiv von Ingeborg Bachmann – diese „populäre Vertreterin des Ich-leide-also-bin-ich-Feminismus“ (Magnus Klaue).
[…] Einer anderen Österreicherin - Christa Wolf, die das authentische weibliche Schreiben in der Kassandra suchte – galt diese programmatische Nekrophilie als eine der Schwächen „der Bachmann“, und als Symptom, dass diese ihren Stoff im »Todesarten«-Zyklus nicht mehr zu fassen bekam. Ausgehend von dem Ausspruch Flauberts „Madame Bovary – das bin ich“, also der Identifikation des Autors mit seiner Protagonistin, erkennt sie dies als die Schwäche von Ingeborg Bachmann, denn „Flaubert war ja eben Madame Bovary.“35 Man könne bei ihm die Trennung von Werk und Autor eben nicht leugnen, so gut die Hürden zwischen beiden auch eingestampft worden seien. „Die Bachmann aber ist jene namenlose Frau aus Malina, sie ist jene Franza aus dem Romanfragment, die ihre Geschichte einfach nicht in den Griff, nicht in die Form kriegt. Die es einfach nicht fertigbringt, aus ihrer Erfahrung eine präsentable Geschichte zu machen.“36 Am Beispiel Bachmanns zeigt sie auf, wie falsch diese Vorstellung von Authentizität ist, die angeblich nur aus Unmittelbarkeit erwachse. Dem Authentischen setzt sie aus diesem Grund auch die Vorstellung einer >Autonomie< voraus, die erst einmal zu erwerben sei, um „authentisch“ zu schreiben. So sah sie zum einen die Frau als „Objekt fremder Zwecke“, das >Es< im Sinne einer Sache, hatte aber zum anderen eine tiefe Abneigung vor jeglicher „Frauenliteratur“und „einen wahren Horror vor jener Rationalismuskritik, die selbst in hemmungslosem Irrationalismus endet.“37 Dabei verfolgte sie in zahlreichen Arbeiten durchaus die Frage, inwieweit es wirklich weibliches Schreiben gäbe. Sie meinte zwar gewisse Spezifika weiblichen Schreibens zu erkennen, die sie in den meisten Fällen nicht näher ausführt, sondern nur auf ihren Status als „Beherrschte“ zurückführt, dabei aber nicht vergisst, dass sie Beherrschte von selbst Beherrschten, Objekte von Objekten, sind: „Jedoch bringt es der Fähigkeit zur Reife nicht näher, wenn an die Stelle des Männlichkeitswahns der Weiblichkeitswahn gesetzt wird und wenn Errungenschaften vernünftigen Denkens, nur weil Männer sie hervorgebracht haben, von Frauen zugunsten einer Idealisierung vorrationaler Menschheitsetappen über Bord geworfen werden.“38 Gelungenes weibliches Schreiben konnte nach Wolfs Sicht nur im „Ringen um Autonomie“ begründet sein. Diese Autonomie ist durchaus im Sinne des klassischen Ichs gedacht. Damit sei das Dilemma aber auch schon begründet – vor allem an jenem ästhetisch zu nennenden Punkt, an dem man „nichts und niemanden mehr vertritt, nur sich selbst“, stelle sich die Frage: „Aber wer ist das? Gibt es das ominöse Recht (oder die Pflicht) zur Zeugenschaft? Zählebige Unterstellung, es müsse immer geschrieben werden.“39 Denn auch wenn sie fragend den Weg von „Sprach-losigkeit zu Ich-losigkeit“40 nachzuvollziehen versucht, gibt es bei ihr keine euphorisch begrüßte Vorstellung einer Literatur, die dem Zwecke diene, die Autorin „anwesend“ zu machen. […] Dabei kann man Wolf wahrlich nicht vorwerfen, blauäugig die Realität zu betrachten. Sie weiß vom „Schmerz der Subjektwerdung.“41 Aber sie weiß gleichzeitig: „Es gibt keinen Weg vorbei an der Persönlichkeitsbildung, an rationalen Modellen der Konfliktlösung, das heißt auch an der Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit Andersdenkenden und, selbstverständlich, Andersgeschlechtlichen. Autonomie ist eine Aufgabe für jedermann, und Frauen, die sich auf ihre Weiblichkeit als einen Wert zurückziehen, handeln im Grunde, wie es ihnen adressiert wurde: Sie reagieren mit einem groß angelegten Ausweichmanöver auf die Herausforderung der Realität an ihre ganze Person.“42 Aus heutiger Sicht erscheint ihr Eintreten für die Bildung eines konsistenten Ichs außerhalb der Literatur ziemlich bemerkenswert. Als Ziel der weiblichen Emanzipation dient ihr ein einheitliches Ich, das zwar durchaus geschlechtlich konstituiert sein könne, das vor allem aber keineswegs im jeweiligen eigenen Geschlecht aufgehe, und gerade deshalb auf einen Austausch und Disput nicht verzichten könne. Keine Spur findet sich hier von einer Ideologie der Einsamkeit, in der die Denkerin oder Dichterin zu ihrem Ich finden könne. […] So düster ihre Urteile, wie jenes, dass von der Ehrfurcht nur die Furcht geblieben ist und das Schaudern dem puren Grauen gewichen ist, auch anmuten, erscheint die Wut als höchst marginales Thema, und ist gewiss kein zu begrüßendes Motiv des Schreibens. Vielmehr kritisiert sie energisch ein zunehmend instrumentelles Verhältnis der Frauen zum Schreiben: „Schreiben für Frauen als ein Mittel, das sie zwischen sich und die Männerwelt legen. (>dann sollen sie mich wenigstens bewundern...<).“43 […] Und doch bleibt letztlich die Frage im Raum stehen: „wie schwer, ja, wie gefährlich es sein kann, wenn wieder Leben in die >Sache< kommt; wenn >es< die Sprache wiederfindet? Als Frau >ich< sagen muss?“44
[…] Trotz >Orlando< ist Virginia Woolf kein Bezugspunkt der neueren feministischen Ästhetik. Damit wird Woolf auch wahrlich kein Unrecht getan. Strenggenommen konnte sie schon kaum als eine Quelle für die ältere feministische Ästhetik dienen. Woolf und der Feminismus standen Zeit ihres Lebens in einem äußerst spannungsreichen Verhältnis zueinander. Ihre eigenen Abgrenzungen von der Frauenbewegung standen in stetigem Widerstreit mit den zahllosen Versuchen einer Vereinnahmung von jener Seite. Sofern man im Falle Virginia Woolfs eine feministische Prägung überhaupt als existent behaupten möchte, müsste man wenigstens nachschieben, dass dieser Feminismus ein streng materialistischer war. Sie selbst nannte dies ihre „Meinung zu einer Nebensache.“45 […] In ihrem Zimmer-Essay, in dem sie Vorträge bündelte, spricht ein fiktives Ich, aber „>ich< ist nur ein zweckmäßiges Wort für jemanden, den es nicht wirklich gibt. (…) Nennen Sie mich (…) wie es Ihnen gefällt – es ist vollkommen unwichtig.“46 Sie spricht hier als Gesamtfrau, deren Name mehr oder weniger austauschbar sei. […] In ihren weiteren Ausführungen beschreibt Woolf die voremanzipierten Frauen als Spiegel bzw. als Gefäß der Männer. Dabei konnte sie kaum absehen, dass dies eine ähnlich fatale Metapher sein sollte wie der marxsche Substanzbegriff, und besonders im Umfeld der feministischen Revisionen der Psychoanalyse eine einschlagende Wirkung erzielen würde. Als Verlegerin der englischsprachigen Schriften Freuds, und ein anatomisches Schicksal anerkennend, wenn auch nicht akzeptierend, ließ sie durchaus süffisante Andeutungen fallen, wie jene vordergründig auf eine schwanzlose Katze bezogene: „Es ist merkwürdig, welchen Unterschied ein Schwanz ausmacht.“ Auch ihre Anmerkung beispielsweise bezüglich guter Autorinnen, „dass keine von ihnen ein Kind hatte,“47 ist keineswegs unbedeutend, jedoch leider nahezu ungedeutet. […] Das Schicksalhafte der Anatomie hielt sie jedoch nicht davon ab, für eine Emanzipation der Frau zu „werben“, müsste man fast schon sagen. Für diese Emanzipation sei der Besitz von Geld (und damit auch das Recht auf Besitz) wie auch das Recht zu arbeiten wesentlich wichtiger als das Wahlrecht – ökonomisch-rechtliche Gleichberechtigung ging ihr somit deutlich näher als politische oder gar aktivistische. […] Die von Christa Wolf ein halbes Jahrhundert später aufgeworfene Frage nach der Schwere oder Gefahr der eigenen Emanzipation für die Frau hat Woolf eigentlich schon verabschiedet: „Alles Mögliche kann geschehen, wenn es keine beschützte Beschäftigung mehr ist, Frau zu sein.“48 Gerade da sich bei ihr absolut nichts holen lässt, das für ein typisch postmodernes Schutzbedürfnis zitiert werden könnte, muss Virginia Woolf an einem gewissen Punkt verschwiegen werden. Zu sehr nahm sie die Frauen in die Verantwortung, indem sie konstatierte, „dass die Entschuldigung des Mangels an Gelegenheit, Ausbildung, Ermutigung, Muße und Geld nicht mehr gilt.“49 Armut und Verborgenheit können temporär notwendige Mittel und leider auch Resultate des Denkens und Schreibens sein, sie bilden jedoch niemals den Zweck des ganzen. Das eigene Zimmer steht somit auch keinesfalls für Einsamkeit oder ähnlich pathetische Selbstbezogenheitsbilder, sondern für eine Privatheit, die „gegen die Ansprüche und Tyranneien ihrer Familie“50 für eine gewisse Zeit bewahren sollte, damit man überhaupt zum Denke kommen könne. […] Die merkliche Anwesenheit des Autors galt ihr noch als der ästhetische Makel schlechthin: „Denn obwohl wir sagen, dass wir nichts über Shakespeares Gemütszustand wissen, sagen wir eben damit etwas über Shakespeares Gemütszustand.“51 Was in heutigen feministischen „Untersuchungen“ als ent_wähntes, normiertes und normierendes sowie nicht kritisch ver_ortetes hegemoniales Diskursgedöns gelten würde, stellt hier das Ziel gelungener Literatur dar. Dabei sind solche Überlegung weit entfernt von einer Forderung nach „Neutralität“, „Abwesenheit“ oder einer Gleichgültigkeit des Autors gegenüber seinem Stoff. Ihre Ausführungen sind vielmehr selbst als Reaktionsformen zu betrachten, in denen sich ihre eigene Abneigung gegen die literarischen Wutausbrüche der schreibenden Frauen artikuliert – in einer Form allerdings, die diese Abneigung aufgehoben und sublimiert hat. Aus eben solcher zur Kritik geformten Wut, in der die Wut selbst verschwindet, entspringt der gelassene und oftmals ironische Ton ihrer Argumentation. […] Den eigenen Adressatinnen setzt Woolf ein Negativexempel vor, das sich bis heute für die prototypische schriftstellerische Feministin anführen lässt: „Sie wird im Zorn schreiben, wo sie gelassen schreiben sollte. Sie wird töricht schreiben, wo sie klug schreiben sollte. Sie wird von sich selbst schreiben, wo sie von ihren Romanfiguren schreiben sollte. (…) In diesen Worten legt sie den Finger präzis nicht nur auf ihre eigenen Mängel, sondern auf die ihres Geschlechts zu jener Zeit.“52 Was heißt aber „zu jener Zeit“? Zorn, Empörung, Unwissenheit, persönlicher Groll, Furcht, Rachsucht und Gram, die sie deutlich als Feinde der Einbildungskraft und des künstlerischen Schöpfns betrachtete - man könnte hinzufügen: des Denkens, des Urteils und der Kritik – erscheinen als Triebfeder des Schreibens aktueller zu sein denn je zuvor. In ihren Überlegungen ließ sie sich von einer konkreten Hoffnung leiten: „Vielleicht beginnt die Autorin, das Schreiben als eine Kunst zu betreiben, nicht als eine Methode der Selbstdarstellung.“53 Eben diese Hoffnung ist im feministischen Geringe um Anerkennung, um Anwesenheit und Sichtbarkeit vollständig kassiert und eliminiert. […] Die Idealbilder weiblichen Schreibens seien nach Virginia Woolf vor allem Jane Austen und Emily Brontë, die beide „schrieben, wie Frauen schreiben, nicht, wie Männer schreiben.“54 Natürlich ist dies ein dezent kryptischer Satz, der sich jedoch in ihre weiteren Ausführungen recht gut einpasst, denn sie verteidigte auf sehr unbestimmte Weise die Differenz der Geschlechter im Alltag und Schreiben. Alle Gleichmacherei – auch geschlechtliche - war ihr zutiefst zuwider, denn „wir ähneln uns ohnehin zu sehr“55 Dass sie dies nicht in einen ästhetischen Differenzfeminismus führte, ist hier definitiv anzurechnen, und rechtfertigt ihre Unbestimmtheit noch einmal. […] Deutlich wird dies erst, wenn man sich Woolfs Charakterisierung wirklich gelungenen weiblichen Schreibens betrachtet: „Männer waren für sie nicht mehr der >Gegner<. (Es war die) erste große Lektion gemeistert; sie schrieb als Frau, aber als Frau, die vergessen hatte, dass sie eine Frau ist, so dass ihre Seiten voll waren von jenem seltsamen Reiz des Geschlechts, der nur einstellt, wenn das Geschlecht sich seiner selbst nicht bewusst ist.“56 Ausgehend von der Motivation der Kunst „die Psyche des Menschen zu ergründen“, legte sie ihren theoretischen wie auch praktischen Fokus auf die nicht-bewussten Anteile an der Kunst, welche selbstverständlich durchaus geschlechtlich sein können. Die Behauptung „ein großer Geist sei androgyn“57 ist tatsächlich noch leicht im bürgerlichen Geniebegriff verhaftet, wie ihr von feministischer Seite immer wieder angekreidet wurde. Im Gegensatz zu denen, die sich von diesem in gänzlich undialektischer Weise verabschiedet haben, rettete sie, ohne dessen ideologischen Motive ungebrochen zu übernehmen, jene seiner Momente, ohne die vorerst nicht auszukommen ist. Zur männlichen Literatur ihrer Zeit zurückkehrend, vermerkt sie nämlich auch deren großes Manko: „ein Schatten etwa in der Form des Wortes >ICH<“58; also „die Vorherrschaft des Wortes >ICH<.“59 Aus Protest gegen die Emanzipation der Frau sei „Männlichkeit jetzt ich-bewusst geworden“60 – in ihren Augen ein großes Vergehen; jedoch keines nur der Männer, sondern ein beidseitiges Vergehen: „Alle, die einen Zustand der Geschlechts-Bewusstheit herbeigeführt haben, sind schuld.“61 Das bemängelte >Ich< ist hier somit gleichzusetzen mit einem Ich, das rein in seinem Geschlecht aufgeht und es nur noch als Maske abbildet, wie sie es ja quasi für ihre erzählende Instanz zu Beginn des Essays noch selbst konstatierte. Von dieser Tendenz nimmt sie Sterne, Yeats und Shakespeare neben zahlreichen anderen jener weißen heterosexuellen, bürgerlichen, weißen Männer aus. In ihrer eigenen Zeit galt ihr vor allem Marcel Proust als Gegenstück zu dieser Geschlechtsbetonung. Wie immer verfuhr sie dabei äußerst ungerecht gegenüber James Joyce, dessen Ulysses sie schließlich als Verlegerin auch ablehnte. [...] Sofern man aus ihrem Essay ein ästhetisches Programm entnehmen kann, lautet dies wohl folgendermaßen: „dass es für alle, die schreiben, tödlich ist, an ihr Geschlecht zu denken. Es ist tödlich, ein Mann oder eine Frau und nichts als das zu sein. (…) Es ist tödlich für eine Frau, irgendeinen Groll auch nur im Geringsten herauszustellen; irgendeine Sache, auch wenn sie gerecht ist, zu verfechten; in irgendeiner Weise bewusst als Frau zu sprechen.“62 Man merkt deutlich, wie sehr Oscar Wilde das künstlerische Denken der spätviktorianischen Epoche geprägt hatte, und wie stark sein Einfluss auf Woolf war. […] Die Ich-Kritik Woolfs zielt auf das Subjekt und nicht auf das Individuum. Letzteres könne sich in der Kunst nur verwirklichen, indem es seine Identität als Subjekt und seine Vergesellschaftung zurückstelle, in ihren Worten „vergisst“. Im politisierten Gedicht hingegen, in dem der Autor sich als Subjekt im Sinne einer Charaktermaske, die eben nur die Personifikation einer gesellschaftlichen Objektivität vertritt, präsentiert, erkannte sie jenes damals neue faschistische Gedicht, diese „abscheuliche kleine Missgeburt“, das so viel mit den heutigen Produktionen gemein hat. […] Bei ihr gerät das Ich im Text hingegen eher zu einem Instrument, um selbst etwas von der Verbindlichkeit der eigenen Urteile zurückzunehmen; es wird verwendet, um ein dezidiert nicht allgemein-gültiges Urteil abzugeben, da sie dazu keine Kompetenz besäße. Solche Selbstkleinmacherei, wie sie sich vor allem durch den Aufsatz „Mr. Bennet und Mrs. Brown“ zieht, erscheint immer eine kleine Spur zu demütig. Trotzdem muss man ihr anrechnen, dass sie den merkwürdigen Weiblichkeitskomplex des Feminismus als nur schlecht sublimierten Männlichkeitskomplex erkannte, dem sie einmal jedoch selbst komplett verfiel. Dessen Produkt, der zehn Jahre nach dem Zimmer-Essay verfasste, überenergische Essay „Drei Guineen“ galt selbst ihrem nähsten Umfeld als schlechteste ihrer Schriften. […] Betrachtet man nun ihre eigenen literarischen Produktionen […]
[…] Vorerst bleibt festzuhalten, dass allein der Bezug auf das Ich sehr viel über die Qualität des jeweiligen Textes verrät, was mit gewissen Einschränkungen andersherum auch gilt: „Der Mensch tut keine nur einigermaßen gesammelte Äußerung allgemeiner Natur, ohne sich ganz zu verraten, unversehens sein ganzes Ich hineinzulegen“63
---
Gekürzt, zusammen- und umgestellt von der Autorin, aus: Paulette Gensler: Warum habt Ihr Angst vor Virginia Woolf? Eine Kritik der feministischen Ästhetik. [bisher ungeschrieben]
---