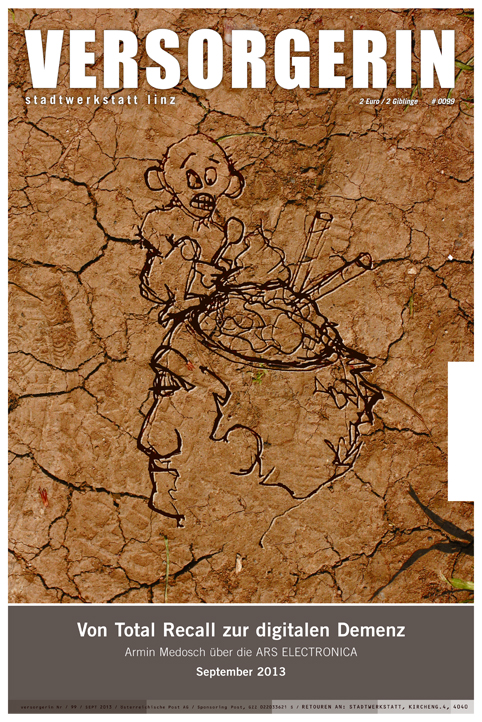Wer sich freiwillig oder von Berufs wegen oft in Bahnhofsbuchhandlungen aufhält, kann den Niedergang des schlechten Geschmacks in Echtzeit beobachten. Der schlechte Geschmack hat eine ehrwürdige Geschichte. In Form des deplacierten Ornaments, des grellen Kitsches und des reißerischen Grauens hat er seit jeher an die Lüge der Kultur erinnert. Als zuverlässiger Begleiter der Hochkultur hat er sie der Anmaßung überführt, mehr sein zu wollen als sie ist, als integraler Bestandteil der Massenkultur war er Index der schlechten Allgemeinheit ihres Glücksversprechens. Sein Missklang rief die notwendige Unversöhnheit beider Sphären, ihre je nur halbe Wahrheit in Erinnerung, die sie unwiderruflich zum Bestandteil des falschen Ganzen macht. Deshalb muss Kunst, sofern sie sich ernst nimmt, die ihr innewohnende Tendenz zum schlechten Geschmack reflektierend in sich aufnehmen. Wo sie sich überheblich gegen ihn sperrt, wird sie zum prätentiösen Kunstgewerbe; wo sie ihm blind folgt, zur stumpfsinnigen Werbung ihrer selbst.
Bahnhofsbuchhandlungen waren lange Zeit ein Ort für jenen Abhub der Massenkultur, der deren Agenten zu peinlich war, um sie auf ihren großen Foren feilzubieten. Deshalb gab es dort seit jeher neben halbseidener Pornographie und abseitigem Obskurantismus auch Krimis im Angebot, zuerst in Form reißerischer Heftromane, später in Buchform. Krimis galten als Abhub, weil sie weder in die Sphäre der Massen- noch der Hochkultur so recht hineinpassten. Um einfach als Schund durchzugehen, hatten sie einen zu strengen ästhetischen Anspruch; bereits im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert haben Kriminalautoren wie der Brite Ronald A. Knox und der US-Amerikaner S. S. Van Dine die Poetik der Gattung in eigenen Regelwerken zu umreißen versucht. Um der Hochkultur zugeschlagen zu werden, waren sie zu sehr auf die eigene Wirkung hin konstruiert, zu schematisch und zu affektbetont zugleich. So landeten die Krimis im Alten Europa an den Orten, wo sich die Wege der Snobs und des Pöbels kreuzten, ohne dass beide einander begegneten, in den Bahnhöfen, den Kiosken der Passagen, in den Trödelläden und auf den Tischen der Kolportagehändler – dort, wo Siegfried Kracauer und Walter Benjamin die fragmentarische Vergegenwärtigung dessen zu entdecken glaubten, was ihnen als verschütteter Wahrheitsgehalt der Populärkultur erschien. Nur in England, wo die populäre Kultur schon immer intelligenter und die Hochkultur selbstironischer war als andernorts, wurde der Krimi als Kunstform von der Bildungselite wie von den Massen geschätzt.
Heute sind Krimis auch hierzulande Teil des Kanons, die Verlage haben ihre Krimireihen aufgelöst, deren Repertoire ins allgemeine Programm integriert und es damit der schönen Literatur der Form nach gleichgestellt. Das bedeutet aber nicht, dass Krimis nun wie im angloamerikanischen Raum auch hier endlich als Kunstform ernstgenommen würden. Vielmehr reagiert der Markt lediglich darauf, dass sie mittlerweile genauso phantasie- und geistlos, genauso professionell und interessenlos zusammengestümpert sind wie die kontrafaktisch noch immer so genannte hohe Literatur, deren zeitgenössischer Exponent kaum zufällig ein Sparkassenangestellter im Geiste namens Daniel Kehlmann ist. Mit den guten Krimis sind auch die wahrhaft schlechten verschwunden, die Orte affektiven Gedächtnisses waren: die gelben Ullstein-, roten Goldmann- und schwarzroten Scherz-Taschenbuchkrimis, deren billiges Layout die heimliche und private Befriedigung von Voyeurismus und Sensationslust versprach und die in ihrer bunten Banalität auf paradoxe Weise als Statthalter der vagen Sehnsucht nach einem aufregenderen Leben fungierten.
Symptomatisch für den zeitgenössischen Stand des Krimis ist kein angloamerikanischer oder skandinavischer Autor, sondern eine deutsche Autorin wie Nele Neuhaus, deren öder Thrillerausstoß heute die Bahnhofsbuchhandlungen dominiert. Ihre Bücher sind nichts als misslungene Coverversionen der jeweiligen amerikanischen, englischen, schwedischen, dänischen Vorbilder, lau wiederaufgekochter Psycho-, Serienkiller- und Pathologeneintopf, und eben deshalb der Ausverkauf dessen, was authentische Trivialliteratur so lesbar macht. Agatha Christie und Edgar Wallace mögen Schund geschrieben haben, das aber ist ihnen hervorragend gelungen; Nele Neuhaus und ihre inzwischen mehrheitlich deutschen Adepten können nicht schlecht, sondern gar nicht schreiben. Hennig Mankell und Elisabeth George mögen ideologischen Müll produzieren, er ist spannend, sofern man die Weltanschauung darin vergisst; der deutsche Normkrimi der Gegenwart, der heutzutage auch von Skandinaviern oder Briten produziert werden kann, besteht nur noch aus Weltanschauung. Seine lieblos zusammengestoppelten Plots wirken wie schmallippige Konzessionen an eine Unterhaltungsform, die man ob ihrer Popularität bedienen muss, die im Grunde aber nur den Drang nach totaler Ethik stört, zu dessen bloßem Ventil die Krimis geworden sind. Es geht längst nicht mehr um die logisch befriedigende Lösung eines Falles, auch nicht um stimmig-abgründige Psychologie, sondern – »Tatort« macht es seit einem halben Menschenleben vor – um die blindwütige, alle Logik und Psychologie unter der eigenen Dynamik begrabende Exekution des einen, unausweichlichen ethischen Existentials, wonach alle Opfer und daher mit ihrem Bedürfnis nach Rache gegen den Rechtsstaat im Recht sind: polizeifeindliche Verherrlichungen der Polizeiarbeit, Staatsfetischismus aus der Feder ehrenamtlicher Staatsfeinde.
Die singuläre Dummheit und Ödnis des deutschen Krimis scheint mit der deutschen Nationalgeschichte zu tun zu haben; jedenfalls brachte die deutsche Literatur noch in der Epoche der Romantik, etwa mit E. T. A. Hoffmanns Erzählung »Das Fräulein von Scudéri«, eine an der englischen gothic novel geschulte Mord- und Schauerliteratur hervor. Bereits in Theodor Fontanes Novelle »Unterm Birnbaum« aber, die wegen ihres peripher kriminalistischen Plots ebenfalls oft als hochliterarischer Krimi rubriziert wird, deren gemütliche Rechtsfallprosa sich aber zu Wilkie Collins verhält wie »Effie Briest« zum unerbittlichen Vorbild »Madame Bovary«, deutet sich vor dem Hintergrund der verspäteten Nationenwerdung die Verquickung von Spannungsliteratur und staatsbürgerlicher Ethik an, die in heutigen deutschen Krimis mit plumpem Selbstbewusstsein auftrumpft. Ein Krimistoff wie die in den neunziger Jahren entstandene britische Profiler-Serie »Cracker«, die keine positiven Identifikationsfiguren kennt und in der die Polizisten potentiell ebenso psychotisch und kriminell sind wie die Objekte ihrer Recherche, wäre in Deutschland nicht denkbar; eine Figur wie der in den siebziger Jahren von Colin Dexter erdachte, am liebsten zu Hause hockende, Kollegialität verachtende, Kreuzworträtseln, dekadenter Lyrik, klassischer Musik und dem Alkohol verfallene Chief Inspector Morse – der komplexeste, witzigste und klügste Detektiv des späteren 20. Jahrhunderts – in ihrer spleenigen Staats- und Bürgerferne erfolglos.
Der österreichische Krimi aber verhält sich zum deutschen wie die Literatur der österreichischen Moderne zur Pausenaufsatzbelletristik der Bundesrepublik. Weil sich in Österreich, das sein Vielvölkererbe nie ganz abgeschüttelt hat, das Bewusstsein erhalten hat, dass Kunst nicht aus Moral, sondern aus Material, Literatur nicht aus Gesinnung, sondern aus Sprache gemacht wird, waren seine Autoren ihrer Weltanschauung stets voraus. Stifter und Grillparzer mögen der Gesinnung nach Reaktionäre gewesen sein, ihrem Werk nach, an dem allein sie zu messen sind, waren sie moderner als je die deutsche Moderne, deren überschätzte Sachverwalter Hans Magnus Enzensberger und Botho Strauß heißen und deren kaum geduldete Ausnahme Arno Schmidt ist. Dessen Tradition lebt, in Einheit mit der handwerklichen Präzision des angloamerikanischen Krimis, heute in Österreich fort. Die Romane von Wolf Haas entlehnen von Arno Schmidt und Thomas Bernhard die am Mündlichen orientierte, dennoch bis aufs Äußerste vermittelte, die Unmittelbarkeit der Anschauung gerade destruierende sprachexperimentelle Diktion und vom guten schlechten Krimi alter Schule die haltlose Faszination am Makabren, Spektakulären, mithin an jenem schlechten Geschmack, dem in Österreich seit jeher auch außerhalb von Bahnhöfen und billigem Schaugewerbe ein Eigenrecht zugestanden wird.
Die jüngste Variante dieser hohen niederen Kunst in der Gattung des Krimis ist die unter Mitarbeit von Haas entstandene Serie »Vier Frauen und ein Todesfall«, die die Verbindung von Gattungsorthodoxie und Satire bereits im Titel trägt, der ebenso auf die Hugh-Grant-Komödie »Vier Hochzeiten und ein Todesfalls« wie auf Agatha Christies Roman »Vier Frauen und ein Mord« anspielt. Die weiblichen Hobbydetektive, die in wechselnder Konstellation die Folgen verbinden, sind authentische Miss-Marple-Nachfolgerinnen, die raffinierten Plots verlangen gespannte Aufmerksamkeit wie die Folgen von »Inspector Barnaby«, aber mit dem grotesken Todesfällen, mit denen jede Folge beginnt, und dem im deutschen Fernsehen unbekannten dialektal vermittelten Sprachwitz knüpft die Serie an Groteskserien wie »Six Feet Under« an. Sprachliche und visuelle Komik hatte schon im Ursprungsformat des österreichischen Fernsehkrimis, der in den siebziger Jahren als absurde Konkurrenz zu »Tatort« ins Leben gerufenen Serie »Kottan ermittelt«, die in sich stringenten und spannenden Plots konterkariert. Wie »Kottan ermittelt« macht sich »Vier Frauen und ein Todesfall« keine Illusionen darüber, dass die Polizei eine Bande ressentimentgesteuerter Trottel, die Bevölkerung ein potentieller Deppenmob und die Täter eigentlich immer genauso unsympathisch wie die Opfer sind; wie »Kottan ermittelt« bindet die Serie ihre Zuschauer nicht durch massenhypnotisch suggerierte moralische Integrität an sich, sondern durch Leitmotive, running gags und spezialistische Anspielungen, die es einem erlauben, die Figuren und die Filme irgendwann wie mit ihren schlechten wie guten Eigenschaften vertraute Freunde zu begrüßen. Weil sie aber, auch daran »Kottan ermittelt« ähnlich, nicht für Kulturwissenschaftler, sondern allein für zufällig begeisterte Zuschauer gemacht ist, wird es in absehbarer Zeit wohl keinen Sonderforschungsbereich geben, der sich mit ihr beschäftigt. Der ausgebildete schlechte Geschmack, den sie bedient, bleibt idiosynkratisch und ist nicht verallgemeinerbar.
Material und Moral
Warum es in Österreich die besseren Krimis gibt, erläutert Magnus Klaue.