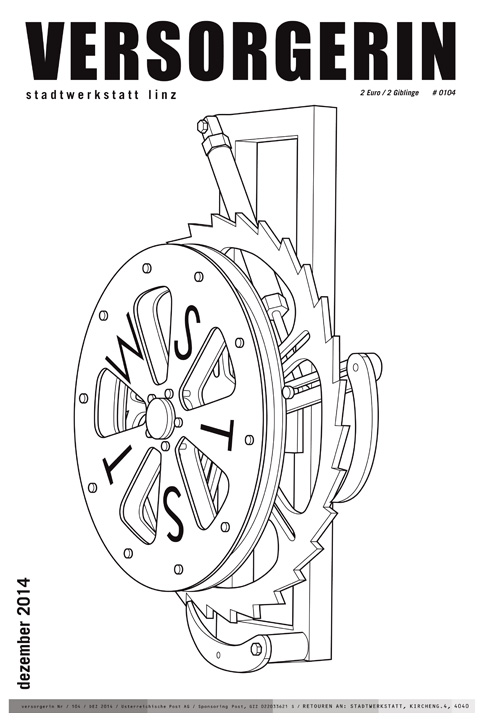Also freilich, mein Herr, kurz vor ‘nem Sehnsuchtsheim / lebt‘s sich mild wie auch wild. Lass uns in Ruh da mit / »Lebenschancenkredit«, was euphemistisch ja / meinte nicht mal ‘nen Sautrog wo. (Aus: Stock und Esel für Erd‘ und Schleim)
Dieses Eingangszitat mag für eine Grundhaltung stehen, die poetische Sprachschöpfung mit Weltbezogenheit und Skepsis verwebt. Um zu Beginn zu beschlagworten: Christian Steinbacher kommt aus dem Feld der experimentellen Texte, hat dort vor Jahrzehnten, wie er im Interview sagt, »im Zentrum begonnen«, um zuletzt 2013 den Heimrad-Bäcker-Preis verliehen zu bekommen. Eine Auszeichnung unter mittlerweile vielen, die sich auch auf seine Tätigkeit als Veranstalter in der Galerie maerz, Kurator, generell als Fachmensch und Festivalmacher der unregelmäßig stattfindenden »Tage der Beweglichkeit« beruft; die sich aber natürlich vor allem auf seine Arbeit als Autor von Poesie, Prosa und Theorie, auf sein Gesamtwerk als vielseitig Sprach- und Textumtriebiger einer »formbewussten Dichtung« begründet. Ganz generell ist die Steinbacher‘sche Sprachschöpfung immer eine Mixtur vieler Ansinnen, der Benennung, Umschichtung, der vielseitigen Referenzen, der Komik, der spielerischen Sprachattacke und der Aushöhlung, der Aushebelung, der Anreicherung, der Rede und Gegenrede, einer in sich stattfindenden sprachlichen Bewegung und Gegenbewegung.
Der aus dem Experimentellen kommende Autor Steinbacher hat sich nun in seinem letztem Buch »Tief sind wir gestapelt: Gedichte« überraschenderweise einem vergessenen deutschen Barockdichter und Rhetoriker, Jacob Balde, gewidmet. Als interessant in der Beschäftigung mit diesem Material hat sich das Konglomerat aus Rhetorik, antiker Wiederbelebung, eines unglaublich »verrückten sprachlichen Durchdrehens« innerhalb des barocken Formenreichtums herausgestellt. Ebenso herausfordernd erwiesen sich die Widersprüchlichkeit von Pathos und Scherz, oder der Gegensatz von hohlen Floskeln und der persönlichen »Einschreibung« des barocken Autors in diese Sprachhülsen. Eine Mixtur, mit der Steinbacher etwas anzufangen wusste, zumal sich dieses Material als durchaus bizarr erwies. Im Hauptteil des neuen Steinbacher-Buches, den »Umschriften zu 24 Gedichten« stellt er die lateinischen Gedichte von Balde mit einer deutschen, wörtlichen Übersetzung aus den 1960er Jahren auf eine Seite, um auf der anderen Buchseite seine eigene, großzügigere Weiterführung von »Übersetzung« zu kredenzen: Um in diesem Bild des Kredenzens zu bleiben, widmen wir uns beispielhaft Steinbachers »Leibgedicht«, eine Übersetzung des Balde-Gedichts »An Simon Lavendula. Über die wunderbaren Fortschritte im Abmagern«. Denn der Dichter und Jesuit Jacob Balde hat im 17. Jahrhundert eine »Kongregation der Dürren« gegründet, der unter anderem die damalige Münchner Schickeria beigetreten ist. Dieser »rhetorischen Schrift«, dem Lob der Mageren, hat Balde allerdings fast musikalisch-kontrapunktisch ein »Trostbuch für die Dicken« beigefügt. Soviel zum Hintergrund über die »wunderbaren Fortschritte im Abmagern«. Steinbacher reichert nun diese Balde-Vorschrift mit Paraphrasen, Gegenzügen an, füllt das barocke Gebälk mit einer nicht-hehren heutigen Alltäglichkeit und rührt kräftig um. Er macht die oben angeführten Fortschritte im Abmagern zu einem Titel »An die letzte Salmonelle. Über manch nicht verwunderliche Weisungen und Neueinsätze«, um innerhalb der Verszeilen auf Tiramisu, Trendsetter, Sartre, das mit Balzac angeblich an der Nase verwurzelte Ich, auf ein fragloses Sein, die Pampa und auf rätselhafte Brasilianer zu verweisen. Bestes barockes Luftgewölk also: Bei Jacob Balde mit der Zutat des Abmagerns als durchaus ironisch zu lesenden Akt der leiblichen Aushöhlung, bei Steinbacher mit allerlei vermischten Zutaten der eigenen Kontextküchen. Dämpfe steigen auf: Das Gefühl von zugleich hohlen wie dicht bebilderten Gebilden stellt sich ein, von luftiger Fülle und Bedeutungsturbulenzen. An manchen Stellen drängt sich der Gedankensprung auf eine sich zwischen Produktion und Sinnent-leerung, zwischen Fülle und Hohlheit zunehmend zwiespältig gebärdenden heutigen Welt auf.
Zu diesen Parallelen befragt: Diese sieht Christian Steinbacher insofern, als dass »das Barock ebenfalls wie die heutige Zeit keine Aufbruchszeit« sei. Das Barock nimmt den Aufbruch der vorangegangenen Epochen, der Aufklärung und der Renaissance wieder zurück, ebenso wie das Biedermeier später sich nach der Vorwärtsbewegung der frühen Romantik auch wieder zurückzieht. Im Gegensatz zum Biedermeier ist das Barock aber noch »draußen und groß« – auch von großen Katastrophen umgeben, der Pest und dem 30-jährigen Krieg. Eine historische Phase, die innerhalb des weltlichen Horrors durch kunstfertige Aufschichtung und Aushöhlung zu kennzeichnen ist – auch wenn, und weil sozusagen »historisch nichts mehr ging«. Dies aber nur als moralisch-ethischer Begleittext, als »beratender Impetus« zum Steinbacherschen aktuellen Werk, das in seinem formalen Metrik-System auch kunstfertige Bezüge herstellt. Es lässt aber einen ironischen Perspektivenwechsel bereits im Buchtitel anklingen, den der sprechenden Gedichte, die von sich selbst behaupten: »Tief sind wir gestapelt« – ihr gewitztes Licht unter den scheinbar bescheidenen Scheffel stellend. Ein Teil des Buches wird außerdem »Verstreutem aus der Zeit« gewidmet. Ein anderer Teil, »Patente Enten«, gibt dem Ärger über ein heutiges, »unentwegtes Reden übers Speisen« Luft, ist also auch Kritik an der belanglosen Bürgerlichkeit.
Um den größtmöglichen Irrtum zu vermeiden, Christian Steinbacher als Traditionalisten zu vermitteln, sei angeführt, dass die Beschäftigung mit dem Barockdichter einem grundsätzlichem Interesse zu verdanken ist, Neues zu unternehmen, also auch im »Experimentellen« nicht konservativ zu werden. Vor allem hat Steinbacher die bereits zuvor gewonnenen sprachlichen Verfahren und Freiräume nicht aufgegeben. Mit dem neuen Buch entsteht nach dem Lesen, sozusagen als Nachbild, der Eindruck von Texten, die zu eigenen körperlichen Gebilden geworden sind: Texturen als kleine, schwebende Einheiten, verwobenes Haufengewölk mit einer jeweils eigenen Struktur und Beweglichkeit an den Oberflächen …. mit Elementen darin, die schon da waren, neu dazukommen, mal herumtreiben, mal andrängen, mal verharren, festhocken, einen anspringen, sich zurückziehen – jedenfalls eigene, unvorhersehbare Richtungsbewegungen vollführen. Die Elemente scheinen herumgereicht, in sich herumziehend, zu Gebilden aufgestapelt, aufgeschichtet – und dieses umtreibende Gesamtbild kann durchaus ebenso als Referenz an die große Fülle und als Kritik am großen Ganzen herhalten. Alle diese Ergebnisse sind also gut angelegte Wege der Uneindeutigkeit.
Wie progressiv sich diese Unterfangen der textuellen und kontextuellen Neulandgewinnung ausgestalten, soll beispielhaft ein anderes Buch von Steinbacher, der Prosatextfluss des 2012 erschienenen »Untersteh dich! Ein Gemenge« untermalen: Dieser widmet sich einer »Herkunft als Fiktion«, mit der Behauptung, letzten Endes »überall herkommen zu können«. Es handelt sich um Texte, die Details von beispielhaften Orten lediglich »hochpumpen«. Diese textlichen »Herkunftspumpen« zeugen von einem Identitätsbegriff, der gar nicht daran denkt, etwas wie Identität nur ansatzweise als etwas Statisches festschreiben zu wollen, sondern Identität geradezu als etwas fiktional Flirrendes erachtet. Zum anderen entstehen interessanterweise auch hier Nachbilder, die die Art und Weise der literarischen Verfahren und deren Beweglichkeit spiegeln – wie etwa hier durch Textpumpen, Textflüsse, inhaltliches Mitgehen oder Konterkarieren.
Welt und Sprachwelt werden bei Steinbacher in Inhalt und Kontext neu verwoben, entkernt, wieder angereichert, sozusagen zwischen großen und alltäglichen Bedeutungsebenen hingemixt und torpediert, Sprache wird gleichzeitig zum seriösen Referenzsystem und zur Grimasse gemacht – jenseits des Sprachgebrauchs einer eigenen Beweglichkeit unterworfen. Um, in seinen Worten, nichts weniger als: »neues Denken, Freiräume zu schaffen, weil es um einen Möglichkeitssinn geht. Letzten Endes geht es immer um Freiheit. Es geht außerdem um Trost, dass alles auch anders sein könnte«. Nicht zuletzt, um der Offenheit des Möglichkeitssinns zu folgen, tritt hier auch der »spielende Mensch, nicht nur der erkennende Mensch« in den Vordergrund. Programmatisch, man möchte sagen, selbstredend, in sich als dialektische Gegenrede angelegt, halten die Texte gleichzeitig ein »Plädoyer für das Reale, Erdige«. Um einen derartigen Poesiebegriff zu umreißen, könnte man einerseits auf einen alten poiesis-Bezug eines »ursprünglichen Verfertigens« zurückgreifen, eines ursächlichen Agierens eines schöpferischen und widerständigen Individuums, oder zum anderen Poesie begreifen als Unruheherd, als sprachliches Mittel zur abweichenden Weltsicht, in den Worten eines Steinbacher-Titels, als »Plädoyer für einen Rest, der nie stillsteht«.
Barocke Sprachturbulenzen
Christian Steinbacher hat im Herbst sein neues Buch »Tief sind wir gestapelt: Gedichte« vorgestellt. Ein Beitrag über dichterische Aushöhlungen, barocke Oberflächen, sprachliche Wolkengebilde – und über die wunderbare Kunst des Abmagerns.
Christian Steinbacher, Tief sind wir gestapelt: Gedichte. Czernin Verlag, 2014, 175 Seiten
http://www.zintzen.org/autoren-authors-auteurs/christian-steinbacher/
Tanja Brandmayr ist Künstlerin, Autorin und arbeitet seit vielen Jahren und in unterschiedlichen Zusammenhängen mit Text, Medien und erweiterten Kunstformaten. Leitung und Programmierung Stadtwerkstatt. (Co)Betreibt die Zeitungen Referentin und Versorgerin.
https://stwst.at/, https://versorgerin.stwst.at/, https://diereferentin.servus.at/, https://quasikunst.stwst.at,
http://brandjung.servus.at/
-Josef-Bauer.jpg)
Jacob Balde, gewischt von Josef Bauer