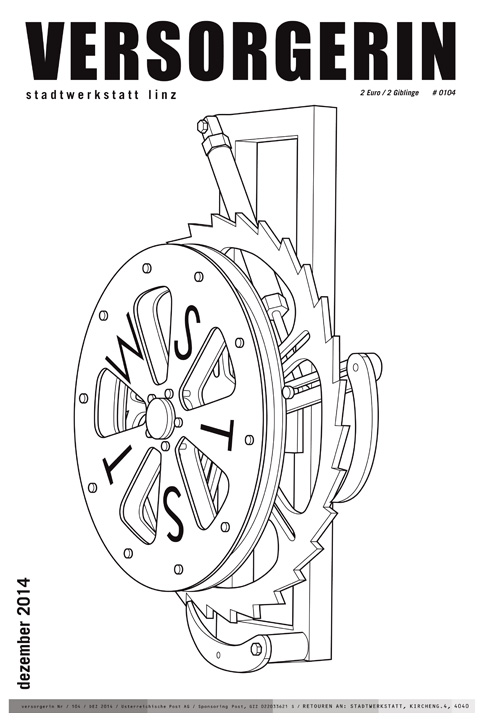Vor 1989 lautete der Lexikoneintrag der Zweiten österreichischen Republik folgendermaßen: Kleinstaat zwischen Alpen und Donau am Rande der westlichen Zivilisation, bedeutende Schwerindustrie (vom Dritten Reich geerbt, von KZ-Häftlingen errichtet), tausende Schigipfel mit Aufstiegshilfen, Hauptstadt Wien gleichzeitig Welthauptstadt der Musik, ansehnlicher Wohlstand, sozialstaatliche Absicherung, reaktionäres Bildungssystem, endemischer Antisemitismus, kaum Mobilität zwischen den sozialen Gruppen. Politisch geprägt von drei Blöcken: der Arbeiterbewegung mit einer der stärksten Sozialdemokratien der Welt, dem Christlich-Sozialen (Volkspartei) und dem NSDAP-Nachfolge-Block (Freiheitliche Partei). Die beiden größten Lager teilen sich die Republik von den Autofahrerklubs bis zu den Fußballvereinen auf, die Freiheitlichen kommen an den Rändern und in Kleinstädten zum Zug. Sozialistische und katholische Jugendverbände sorgen für Kadernachschub, bei den Freiheitlichen übernehmen das die Burschenschaften, die das Kriegsende als Tag der Katastrophe beklagen.
So lief das ein halbes Jahrhundert. Im Leben von Staaten ist das eine lange Zeit, noch dazu im östlichen Mitteleuropa.
Mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten und dem Beitritt Österreichs zur EU im Jahr 1996 änderte sich der Eintrag. Vom Kleinstaat ist nicht mehr die Rede, da so viele Kleinststaaten der EU beitraten. Österreich rückte zu einem Mittelstaat auf, der geringe Arbeitslosenzahlen, die jüngsten Frühpensionisten, einen hoch monopolisierten Mediensektor und eine besonders einseitige Vermögensverteilung aufweist. Die beiden traditionell führenden Blöcke erreichen zusammen keine parlamentarische Mehrheit, die postfaschistische Honoratiorenpartei wandelte sich unter Jörg Haider zu einer Massenpartei, die sich auf rechtsextreme Mobilisierungen all jener versteht, die beim Weltenlauf zurückbleiben oder bereits ausgeschieden sind. Die Gefahr einer Machtübernahme der Strache-FPÖ ist gering. Hatte bei den Wahlen 2013 das Antreten des austrokanadischen Milliardärs Frank Stronach (dessen MAGNA-Konzern Industries einst Opel schlucken wollte) die Regierung gerettet, so gibt es nun mit den Grünen und den liberalen Neos genug potentielle Koalitionspartner.
Vor kurzem erschien eine umfangreiche Monografie des Wiener Politikwissenschaftlers Emmerich Tálos über das Herrschaftssystem des Austrofaschismus [1], die auch für die Untersuchung der Gegenwart wichtige Erkenntnisse liefert. Tálos zeigt den Alpenfaschismus als Zwitterwesen zwischen geiferndem Antimarxismus und penetranter Deutschtümelei. Österreich als der bessere deutsche Staat, tönten die Herren Dollfuß und Schuschnigg, nachdem sie mittels Standrecht und Eisenbahngeschützen die Arbeiterbewegung zerschlagen hatten. Europa wunderte sich über den »besseren deutschen Staat«, Hitler bedankte sich für die Liquidierung des Autromarxismus und wußte: Von den Knallköpfen unterm Kruckenkreuz (einem Kreuzfahrersymbol, es sollte das »bessere« Hakenkreuz darstellen) war auf die Dauer kein erstzunehmender Widerstand zu erwarten. Achtzig Prozent der Funktionäre der Vaterländischen Front (die Massenorganisation des Regimes) waren noch nach vier Jahren arbeitslos. Eher bekommen freigekommene Nazi und Linke, die 1934 in Anhaltelager gesperrt worden waren, einen Arbeitsplatz als die eigenen Leute, beschwerte sich die Basis. Mit einer strikten Austeritätspolitik (der Schilling trug den Spitznamen Alpendollar) wurde aus einer angestrebten Entfesselung der ständischen Wirtschaft ein Land der Massenarbeitslosigkeit und des Elends. Bankenzusammenbrüche und internationale Sparauflagen begleiteten den Niedergang. Zur selben Zeit setzten die Nazi im Deutschen Reich auf einen Kriegs-Keynesianismus mit Vollbeschäftigung und Produktionsrekorden unter Bedingungen von Zwangsarbeit und extremer Ausbeutung.
Tálos legt den »tiefen Staat« hinter der politischen Oberfläche des Austrofaschismus frei; das Konglomerat von kirchennahen Kapital- und Bankengruppen und schwerindustriellen Zentren in den Bergen, die oft unter deutschnationaler Führung standen. Er räumt auch mit der Legende auf, die Austrofaschisten seien nicht antisemitisch gewesen.
Ihr Antisemitismus war nicht terminatorisch wie der deutsche, aber er war schlimm genug. Letztlich diente auch er wie so vieles im Austrofaschismus der Einstimmung auf die NS-Herrschaft, den totalen Krieg und die Shoa.
Betrachtet man die Republik unter Einbeziehung des tiefen Staates, stößt man auf die erstaunliche Tatsache, dass alle Lager in wenig veränderten Konfigurationen weiter existieren.
Das einzige Lager, das nennenswerte Metamorphosen mitmachte, ist das deutschnationale. Österreich ist arm an Metropolen, aber reich an Kleinstädten, in denen sich Burschenschaftermilieus reproduzieren. In den 70er Jahren waren die »Freiheitlichen« auf eine enge Honoratiorenpartei geschrumpft, Kreiskys Wahlrechtsreform des Jahres 1970 rettete sie vor der Auflösung. Sein Kalkül, die ÖVP mit Hilfe der Ex-Nazi zu übertrumpfen, ging auf und führte die SPÖ in die erste von drei absoluten Mehrheiten. Chef der Freiheitlichen war ein oberösterreichischer Schulinspektor namens Friedrich Peter. Der ehemalige SS-Mann war immer dann auf Urlaub, wenn seine Einheit hinter der Front Massenexekutionen durchführte (sie tat nichts anderes). Nach dem Krieg war Peter Ziehsohn des hohen SS´lers und Kaltenbrunner-Freundes Anton Reinthaller, der die FPÖ 1955 gründete. Bruno Kreisky stellte sich, als die Vorwürfe gegen Friedrich Peter bekannt wurden, auf die Seite Peters und gegen Wiesenthal. Sein Lebenswerk, die Aussöhnung mit den Nazis, ging vor.
Ende der achtziger Jahre stand die FPÖ wieder vor dem Untergang. Liberale wurden von den »alten Herren« torpediert. Die Rettung erwuchs aus den eigenen Reihen und trug den Namen Jörg Haider. Er erweiterte das »Dritte Lager« durch eine Melange aus Neofaschismus, Klassenkampfrhetorik und Chauvinismus (darin Viktor Orbán nicht unähnlich) zu einer diffus-reaktionären Protestpartei, die besonders bei der Jugend und Arbeitern Mehrheiten erzielte. Als die Burschenschafter seinen Kurs torpedierten, gründete er eine neue Partei, die nach seinem Tod 2008 auslief. Mühelos gelang es der alten FPÖ, begünstigt durch steigende Arbeitslosigkeit und an Deutschland orientierten Verschärfungen im Sozialbereich, wieder zu einer Mittelpartei aufzusteigen. In der neuen Strache-FPÖ besteht die Hälfte der Parlamentarier aus Burschenschaftern. Groß ist der Einfluß der Partei im Sicherheitsapparat. Eine Hausbesetzung von 19 Jugendlichen bekämpften Polizei und Sondertruppen mit 1700 Mann, Hubschraubern und Panzerspähwagen. Auch der Wiener Polizeipräsident kommt aus Burschenschafterkreisen.
Nach der Bildung des Kabinetts Faymann II (SPÖ) rief der Ende August 2014 entnervt zurückgetretene ÖVP-Chef, Vizekanzler und Finanzminister Spindelegger die Worte »Es geht um die Entfesselung der Wirtschaft!« ins Publikum. Der Biedermann beschwor eine Umwälzung der Verhältnisse. Ganz Österreich lachte. Doch der Mann hatte recht.
Im Kapitalismus der großen Monopole ist die Konkurrenz der Großkonzerne nicht abgeschafft, sie ist deren Bewegungsform. Kleinere Nationen und mittlere Kapitalien haben diese »Entfesselung der Wirtschaft« um den Preis des sonstigen Untergangs nachzuvollziehen. Versäulte Staaten tun sich damit schwer, sie stagnieren. Es gibt Zwangsmitgliedschaften bei den Kammern (die Arbeiterkammer hat sich gleich in die Verfassung hineinreklamiert), Krankenkassen schränken trotz hoher Gewinne ihre Leistungen ein (und öffnen damit die Tür für Privatisierungen), Ersparnisse von Lohnabhängigen und Selbständigen werden durch niedrige Zinsen entwertet und umverteilt und kleinere Unternehmen betteln vergeblich um Bankkredite. Zur selben Zeit fließen Dutzende staatliche Milliarden für Banken, die sich in Osteuropa übernommen haben.
Die Ausdehnung des Weltmarks ins hinterste Alpental versetzte jene Partei, die wenigstens die Erinnerung an eine Volkspartei erhalten will, in eine strukturelle Dauerkrise und wird sie früher oder später wie die Democrazia Christiana enden lassen, als toter Ast am Baum der Geschichte. Daß sie sich mit dem neuen Vorsitzenden Mitterlehner angesichts eines inferioren Kanzlers Faymann jetzt im Höhenflug wähnt, ändert daran nichts. Finanzminister Schelling exerzierte als Chef der Sozialversicherungen vor wie man umfassend Sozialabbau betreibt und die Krankenkassen für Privatisierungen vorbereitet. Er wird sich bald in die Reihe gescheiterter ÖVP-Finanzminister (Molterer, Pröll, Fekter, Spindelegger) einreihen.
Achtzig Prozent der Gesetze werden in Brüssel erlassen, der Bund hat wenig, die Länder und Gemeinden haben gar nichts mitzureden. Dennoch erhalten die Länder ein Drittel der Staatseinnahmen zur fast freien Verfügung. Die Reaktionen auf die Einengung des politischen Raums in Österreich sind grotesk. Jene Ebene, die am meisten an Bedeutung verlor und ohne Einbuße an staatlicher Steuerungsqualität aufgelöst werden könnte, die Landesregierungen, verzeichnet den größten Machtzuwachs. Österreich ist kleiner als Bayern, leistet sich aber neun Schrebergartenregierungen, deren Landesräte im Ministerrang stehen. Allein die Sonderpensionen für das Regierungspersonal würden eine österreichweite Öffnung aller Kindergärten bis 19 Uhr finanzieren. (In Niederösterreich und Vorarlberg sperrt die Hälfte mittags zu). Am Beispiel der Wohnbauförderung kann der Marsch der Länder auf Wien in seiner ganzen Glorie nachvollzogen werden. Die Wohnbauförderung, die seit 1945 zwei Drittel aller Wohnungen mitfinanzierte, wurde den Ländern übertragen, worauf diese die Zweckwidmung über Bord warfen und mit den Steuermilliarden auf den Finanzmärkten spekulierten. Nur die riskantesten Finanzderivate waren für Salzburg, Tirol und Niederösterreich gut genug. Es dauerte nicht lang, und die Gelder waren wie bei den Milliardenspekulationen Kärntens mit seiner Hausbank oder jenen der Gewerkschaftsbank in US-amerikanische Immobilien verloren. Der Bund musste rettend einspringen. Allein das Kärntner Finanzdebakel beläuft sich auf 20 Milliarden Euro – die vom Bund und damit den Steuerzahlern beglichen werden müssen. Umgelegt auf deutsche Verhältnisse wären das rund 180 Milliarden. Und die Konsequenz aus dem systematischen Versagen der Länder? Man diskutiert die gänzliche Übernahme der Schulpolitik und das Recht auf eigene Steuereintreibung.
Längst ist die Landeshauptleutekonferenz, die vor Jahrzehnten als loser Diskussionsklub eingeführt wurde, bedeutsamer als die Beschlüsse des Ministerrats. Sie ist nicht einmal ein Verein, hat keine juristische Form und hat in ihrer materiellen Bedeutung auch die vielbeschworene Sozialpartnerschaft überrundet (begünstigt durch die de facto Machtlosigkeit der Gewerkschaften durch deren selbstverschuldeten Bankrott). Die vier größten Bundesländer halten sich in Wien eine Regierung. Und der Kanzler ist glücklich, wenn er einen Termin bei einem Landesfürsten erhält.
Die SPÖ kommt mit den politökonomischen Veränderungen am besten zurecht. Seit Jahrzehnten ist sie ein Kanzlerwahlverein mit angeschlossener Pfründevergabe. Man kümmert sich um die noch nicht zur FPÖ abgewanderten Stammwähler, die Pensionisten der Stadt Wien. Aus dem Primat der Partei ist der Primat der Gewerkschaft geworden. In Ägypten gibt es die halbamtliche Tageszeitung »Al Ahram«. Sie druckt den Willen des Pharao. In Österreich gibt es ein Pendant, die »Kronen Zeitung«, die Zeitung mit der größten Verbreitung in der westlichen Welt. Es gibt keine politische Entscheidung ohne deren Zustimmung. SPÖ-Vorstandsmitglieder lernen rasch, dass wichtige Änderungen zuerst dort verlautbart werden. Mit der »Krone« blüht auch der Antifaschismus. Zwar besorgt sie in jedem Satz das Geschäft der FPÖ, aber die Anzeigen der SPÖ stellen das Gleichgewicht wieder her. Dem Werbeslogan »Schau in die Krone« kommt daher eine tiefere Bedeutung zu.
Und die Steuerreform? Wird darauf hinauslaufen, dass die Lohnabhängigen und die Mittelschichten sich Steuererleichterungen durch ausgleichende Verschlechterungen selber zahlen. Die Landeshauptleutekonferenz ist nämlich gegen eine Millionärssteuer. Es wird die Aufgabe des Kanzlers sein, diese Position der Bevölkerung via Kronen Zeitung als Regierungswille mitzuteilen. Der Gewerkschaftsbund kämpft mit letztem Einsatz: er hat eine Unterschriftenaktion auf den Weg gebracht.
[1] Emmerich Tálos: Das austrofaschistische Herrschaftssystem. Österreich 1933-1938. Wien: Lit Verlag 2013
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von »konkret«