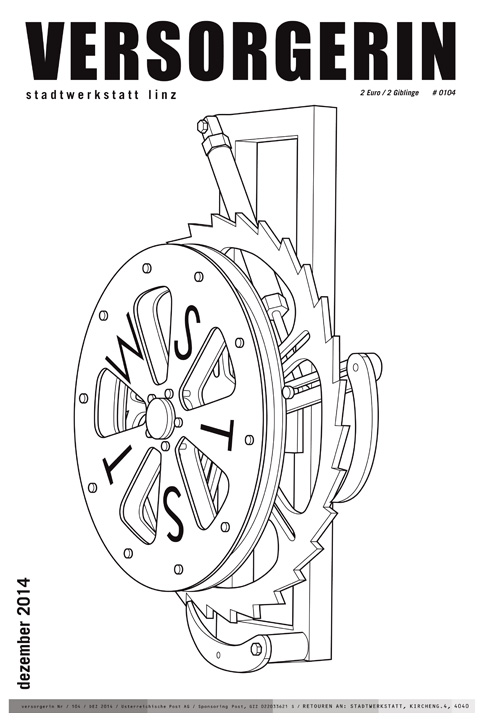»Filmmusik braucht Raum, um sich entwickeln zu können. Der Film muss der Musik Zeit geben, um sich zu entwickeln.« Die Äußerung des italienischen Komponisten und Dirigenten Ennio Morricone, der vor allem durch seine Filmmusik für die Italo-Western Sergio Leones bekannt geworden ist, scheint das Arbeitsverhältnis umzukehren, in dem Film und Musik nach gängiger Meinung zueinander stehen: Nicht die Musik soll dem Film zu Diensten sein und zum integralen Moment von dessen ästhetischer Formensprache werden, sondern der Film hat der Musik »Raum« und »Zeit« für deren eigene Entwicklung zu gewähren. Sofern Filmmusik nicht als bloße Illustration oder akustischer Emotionenverstärker, sondern als integrales Moment ästhetischen Ausdrucks angesehen wird – sofern also dem Film wie den anderen Künsten die Möglichkeit ästhetischer Eigengesetzlichkeit zugetraut wird –, handelt es sich allerdings tatsächlich nur um eine scheinbare Umkehrung. In Wahrheit wendet sich Morricones Formulierung lediglich gegen die verbreitete Annahme, der Musik könne im Film keine andere Funktion als die der Illustration oder Emotionalisierung zukommen. Musik im Film wird demnach rein instrumentell eingesetzt, zwecks Akzentuierung der Spannungsdramaturgie, zur Unterstreichung der Gefühle der Figuren, zur Manipulation der Affekte des Publikums, mitunter auch rein formal, um den Wechsel der räumlichen und zeitlichen Lokalisierung der Handlung zu begleiten, ähnlich den verschiedenen Formen von Schnitt und Überblendung auf der Bildebene.
Schon der klassische Hollywood-Film, von dem dieses Modell abgezogen ist, hat ihm nie in jedem Detail entsprochen. Vielmehr blieb dem Hollywood-Kino immer auch die Funktion von Musik in Zeiten des Stummfilms präsent, als sie zugleich nebensächlicher und bedeutender war: Im Stummfilm bildet die Musik einerseits eine Art Klangteppich, bloßes Nebenherspiel, das dem Film gleichsam untergelegt ist, so dass jeder Stummfilm immer wieder neu und anders musikalisch »vertont« werden kann. Andererseits ist dieser Klangteppich, als klanglicher Kontrapunkt zum stummen Bild, notwendige Bedingung der Rezeption des Stummfilms, der in seiner pantomimischen Stille vom Publikum nicht ertragen werden könnte, liefe nicht als Begleitung eine musikalische Tonspur mit. Überdies kommt der Musik im Stummfilm, da sie reines Nebenherspiel war, paradoxerweise größere Autonomie zu als später in vielen Tonfilmen. Sie konnte sich neben dem Film, von ihm weg, gegen ihn und über ihn hinaus entwickeln, dem jeweiligen Interpreten war dadurch viel Raum für Abschweifung und Improvisation gelassen.
Die Erinnerung an diese Bedeutung der Musik im Stummfilm hat den Hollywood-Film nie ganz verlassen. Das wird am deutlichsten an Filmen von Regisseuren, die Stumm- und Tonfilm gleichermaßen kannten, an Ernst Lubitsch etwa oder Billy Wilder, besonders aber an Alfred Hitchcock, der in den fünfziger und sechziger Jahren mit Bernard Herrmann auch einen der ersten Filmkomponisten verpflichtete, die der Musik auf dem Stand des Tonfilms jene Möglichkeiten erschlossen, die Morricone einforderte. Herrmann, 1911 geboren und aus einer jüdischen Mittelklassefamilie stammend, studierte an der Juilliard School in New York, arbeitete in jungen Jahren mit Aaron Copland zusammen, der vor allem Bühnenmusik komponierte, und war zunächst für den Rundfunk tätig. Über Orson Welles, bei dessen Hörspiel »War of the Worlds« er 1938 die musikalische Leitung übernahm, gelangte Herrmann zum Film. Mehr noch als mit Welles, für den er die Musik zu »Citizen Kane« (1941) schrieb, traf er sich mit Hitchcock in dem Bemühen, dem Film gerade durch Autonomisierung der Musik neue genuin filmische Möglichkeiten zu erschließen. In einer berühmten Sequenz von »The Man Who Knew Too Much« konvergieren 1956, einmalig in der damaligen Kinogeschichte, Musik im Film und Filmmusik: Herrmann selber dirigiert in der Londoner Royal Albert Hall die »Storm Clouds Cantata« des australischen Komponisten Arthur Benjamin, deren abschließender Beckenschlag den Schuss übertönen soll, den ein politischer Attentäter auf einen hohen Diplomaten abfeuert. Die Musik im Film fungiert in der im Übrigen stummen Szene zugleich als konventionelle Emotionenverstärkung und als handlungskonstituierendes Moment, sie wird als Filmmusik zur Begleitung dessen, was auf der Handlungsebene ohne sie gar nicht stattfinden könnte. Morricones Wunsch wird hier buchstäblich übererfüllt: Nicht allein gibt der Film der Musik Raum und Zeit, um sich zu entfalten, sondern die Entfaltung der Musik in Raum und Zeit ermöglicht erst die filmische Handlung und strukturiert die Bild- und Spannungsdramaturgie.
Künstlich erzeugte Geräusche statt Musik hat Hitchcock 1963 in »The Birds« eingesetzt, deren Sounddesign Herrmann überwacht hat. Die elektronisch erzeugten Toneffekte steuerte der deutsche Komponist Oskar Sala bei, ein Schüler Paul Hindemiths. Die elektronischen Klänge werden hier nicht als verfremdende Begleitung kontrapunktisch zur Handlung eingesetzt, sondern – darin der Orchestermusik in »The Man Who Knew Too Much« ähnlich – zu Elementen der Handlung selbst: Das komplette Vogelgekreisch des Films ist elektronisch erzeugt, wobei die Divergenz zwischen realem und artifiziellem Geräusch in der Wahrnehmung des Zuschauers eine Verunsicherung auslöst, die den Schrecken des Films und den Eindruck der Irrealität zugleich verstärkt. Für die Duschmordszene von »Psycho« (1960), ein Film, der ursprünglich ganz ohne Musik konzipiert worden war, komponierte Herrmann die dissonanten Violinenschreie, in denen wiederum der Klang aus eigener Dynamik die Grenze zum Geräusch überschreitet und die die Vorlage für etliche Filmmusiken im Horrorfilm und Thriller boten.
Dass insbesondere die Musik in modernen Thrillern und Horrorfilmen Verfahrensweisen der Neuen Musik verwendet, ist eine zur Phrase gewordene Erkenntnis, die der Komponist Cornelius Schwehr 2008 in einem Vortrag, der zu den wenigen Beispielen für die Auseinandersetzung eines Komponisten von »E-Musik« mit Filmmusik zählt, triftig kritisiert hat: Wenn Neue Musik oder ihr entnommene kompositorische Techniken in einem Film eingesetzt werden, so Schwehr, entstehe keine »Neue Filmmusik«, die irgendwie avancierter und komplexer als die konventionelle sei, sondern bestenfalls ein Film, der sich der Neuen Musik in angemessener Weise als Ausdrucksmittel bediene. Es handelt sich insofern um eine Technik der Kulturindustrie, zu der der Film als industriell produzierte Kunst, unabhängig vom Gehalt der einzelnen Werke, a priori zählt: Abgespaltene Momente des Formenrepertoires avancierter Kunst werden dem eigenen Verfahren eingefügt, wobei vom immanenten Formgesetz der Musik notwenig abstrahiert und diese zum mal bloß begleitenden, mal widersprüchlichen, mal ästhetisch oder dramaturgisch bestimmenden Moment des jeweiligen filmischen Verfahrens wird. Tatsächlich gibt es seit Entstehung des Tonfilms keine vom Film unabhängig existierende Filmmusik: Die Musik wäre nicht ohne den Film, zu dessen Tonspur sie ebenso gehört wie Stimmen und Geräusche. Eben das verleiht ausgekoppelten und auf CDs veröffentlichten Filmmusiken stets einen schalen Beigeschmack; man hört sich so etwas, gerade wenn es im Film beeindruckend war, nicht unabhängig vom Film an, ohne Überdruss zu empfinden.
Den Prozess der Abspaltung, Verdinglichung und Instrumentalisierung »ernster« Musik im Film hat Theodor W. Adorno in vielen seiner musiktheoretischen Schriften als Symptom der Entautonomisierung von Kunst in der Kulturindustrie beschrieben – am Beispiel klassischer Musik, aber auch anhand der Zusammenarbeit von Komponisten der Moderne wie Igor Strawinsky mit der Filmindustrie. Die Integration von Techniken und Kompositionsformen Neuer Musik in den Film ist also nichts qualitativ Neues. Neu ist allenfalls jenes Genre des Vulgärkunstfilms, der eine herabgesunkene filmische mit einer banalisierten musikalischen Moderne verschmilzt. Exemplarisch dafür ist die langjährige Zusammenarbeit zwischen Peter Greenaway und Michael Nyman, in der pompöse filmische Leere mit dem Abhub der Minimal Music in unerträglich öden Endprodukten zusammenkommen. Neu, wenngleich Adornos Analysen nicht widersprechend, mag auch sein, dass in manchen modernen Horrorfilmen Formen Neuer, insbesondere elektronischer Musik nicht nur adaptiert, sondern antizipiert werden: Der fast ausschließlich aus elektronischen Klängen an der Grenze zum Geräusch bestehende Soundtrack von »The Texas Chainsaw Massacre« (1974), den Regisseur Tobe Hooper gemeinsam mit Wayne Bell schrieb und der wesentlich zu der hochgradigen Verunsicherung beiträgt, die dieser amateurhaft rohe, keiner traditionellen Spannungsdramaturgie folgende Film heute noch auslöst, erscheint tatsächlich als Vorklang von vielem, was in der Neuen Musik durch Elektronik zwecks Erzeugung bislang ungehörter Geräusche, die sich keinem »Klang« subsumieren lassen, erst seit den achtziger Jahren entstanden ist.
Da auch Hooper und Bell an Verfahren anschlossen, die in der Neuen Musik bereits entwickelt worden waren, ändert das aber nichts daran, dass sogenannte E-Musik im Film stets zum Moment des jeweiligen filmischen Verfahrens und insofern heteronomisiert wird. Dies gilt auch, wo sie (wie die Musik Beethovens in Stanley Kubricks »Clockwork Orange« von 1971) als ironischer gesellschaftskritischer Kommentar fungiert oder wenn sie, wie in den Soundtracks, die Ennio Morricone zu den Gialli, den Krimireißern von Dario Argento aus den siebziger Jahren schrieb, der Spannungsdramaturgie der Filme entgegenarbeitet: Morricones Thriller-Soundtracks entwickeln bevorzugt für hochdramatische Szenen langsame, hypnotisch gedehnte Soundtracks, während leere, spannungslose Sequenzen mit aufreizend-nervösen Klängen unterlegt werden. Der dadurch entstehende Widerspruch, der diesen Thrillern einen psychedelisch-irrealen Charakter verleiht, ist freilich wiederum konstitutiv für die Filme, nicht für die Musik, weil er erst als filmischer überhaupt erfahrbar ist.
Der Einsatz »ernster« Musik im Film ist also auch im Fall Neuer Musik stets nur als kulturindustrielle Technik beschreibbar. Ihn als solche zugleich abstrakt zu verwerfen, ist aber nur möglich, wann man dem Film, eben weil er Produkt und Teil der Kulturindustrie ist, von vornherein den Status einer autonomen Kunst abspricht. Auf diese Idee – für die man sich nicht auf Adorno berufen kann, der den Film allein aus produktionsästhetischer Sicht und nicht unter dem Aspekt filmischer Formsprache in den Blick nahm – kann aber nur kommen, wer vom Kino mit der gleichen Borniertheit nichts als »Unterhaltung« fordert, wie von der hohen Kunst nichts als die sogenannte »ästhetische Erfahrung«. Abstrakt auf dieser Trennung zu bestehen, die von Filmen wie denen, an denen Morricone mitarbeitete, gerade in Frage gestellt wird, ist selbst Symptom der Erfahrungslosigkeit, die im selben Atemzug beklagt wird.
Neue Geräusche
Über das Nachtönen und Vorklingen von ernster Musik in der Filmmusik.