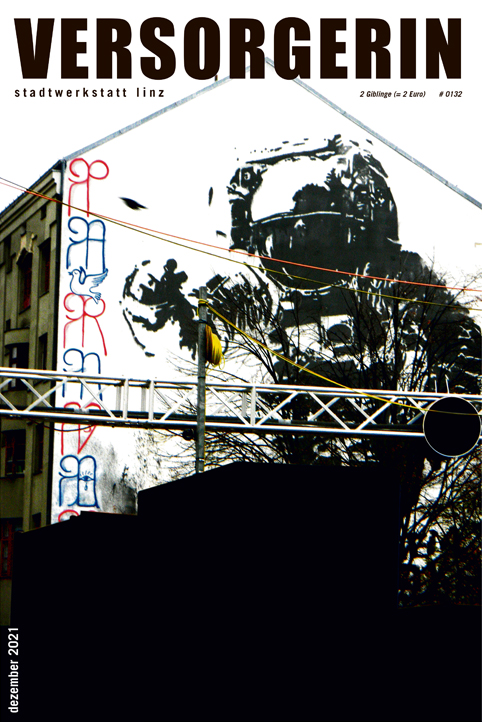Liest man sich ein paar der unzähligen Texte durch, die in den letzten Monaten über Identitätspolitik geschrieben wurden, dann folgen sie alle einer ähnlichen Legende: Identitätspolitik sei ein Produkt des US-amerikanischen Universitätsbetriebs, das nun auch in Europa auf dem Vormarsch sei und von einzelnen Ideologen hinterhältig in alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche getragen werde. Das Opfer sei – durch die Bevorzugung von Gruppenidentitäten vor dem Gemeinsinn – der soziale Frieden. Als einzige Rettung verbleibe der klassische Liberalismus, der für einen sachlichen Diskurs und Pluralismus sorge. Dieser oft variierten, im Kern aber immer gleichbleibenden Analyse liegen mehrere Fehleinschätzungen zugrunde.
So stoßen sich die behäbigen Beschützer des Diskursklimas in erster Linie am rauen Umgangston des vermeintlichen Gegners. Debatten, die ruhig und konstruktiv geführt werden könnten, verkämen im Fahrwasser der Identitätspolitik zu erbitterten Gefechten, aus denen Ausgrenzung und Polemik erwüchsen. Ein rassistisch argumentierender Antirassismus oder ein den Körper diskursiv leugnender Queerfeminismus wären jedoch nicht harmloser, wenn ihre Abgesandten sich öfter in nüchterne Gesprächsrunden begeben würden. Wenn etwa die immer freundlich lächelnde Kopftuch-Aktivistin und von einer dritten Intifada schwärmende Linda Sarsour über ein Opfer von islamischer Genitalverstümmelung, Ayaan Hirsi Ali, schreibt »I‘d like to take her vagina away, she doesn‘t deserve to be a woman«, das wahhabitische System Saudi-Arabiens verteidigt und alldem zum Trotz als feministische, linke Diversity-Ikone herumgereicht wird, liegt weit mehr Regression vor als nur ein unfreundliches Diskussionsklima.
Die liberale oder wahlweise auch liberal-konservative Kritik an der Identitätspolitik ist oft nicht nur verkürzt, sie wagt auch nichts. Wenn sie anprangert, dass der identitätspolitische Antirassismus und Queerfeminismus für Frontenbildung und dichotomes Gut-Böse-Denken sorge, nimmt sie sich selbst aus der Rechnung hinaus und übersieht so, dass sie sich ähnlich versimpelte Weltbilder zimmert. Ob nun affirmativ oder scheinbar kritisch über Identitätspolitik gesprochen wird, die gängigen Parolen sind nicht weit: Unsere Gesellschaft sei gespalten, es herrschten »Denkverbote«. Dabei dient der abstrakte Verweis auf Meinungsfreiheit oft vor allem dazu, sich vorab schon gegen Widerspruch und Kritik abzuschirmen, obwohl Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne heißt, dass der Souverän diese nicht verbieten oder zu sehr einschränken darf. So ist die Holocaust-Leugnung berechtigterweise verboten; Blasphemie hingegen, die den sozialen Frieden stört, unberechtigterweise. Bei (Rechts-)Libertären firmiert die Meinungsfreiheit jedoch als ein Begriff, der sich auf den politischen Kampf zwischen Gruppierungen bezieht, womit er ebenso idealistisch gebraucht wird wie von der Lifestyle-Linken und zu den gleichen Ergebnissen führt: Die konservativen Kritiker von Identitätspolitik und Cancel Culture fordern nicht selten ähnlich rigide Tugendgebote und identitäre Gemeinschaftsangebote wie die linken Überkorrekten, nur eben unter der Ägide konservativerer Ideale.
Warum sich überhaupt gezankt wird, wenn die verfeindeten Fronten beide in ihrer Lobhudelei des zum Götzen erhobenen Pluralismus übereinkommen, wäre die derzeit dringlichste Entgegnung auf die scheinbar endlosen Feuilleton-Debatten. Denn genauso wie die Identitätspolitik nur vielfältige (Opfer- und Täter-)Perspektiven kennt, die sie gesellschaftlich ordnen, verwalten und hierarchisieren will, so findet sich kaum Kritik an der Identitätspolitik, die bereits ihre Prämissen als Lügen entlarvt. Nur so ist es möglich, dass im Regelwahn der Antidiskriminierungs-Maschinerie noch »wichtige Anliegen« ausgemacht werden, obwohl bereits das Zugeständnis, dass sich Politik an Identitäten und nicht etwa an dem Streben nach Wahrheit ausrichten solle, erster Grundsatz der identitären Denkart ist. Während die einen sich vor Triggern fürchten und darunter jeden kritischen Einwand subsumieren, bangen die anderen um eine konstruktive Debattenkultur, sobald einmal jemand darauf insistiert, dass eine Diskussion nicht mit geisttötenden Kompromissen, sondern begründeten Urteilen enden sollte. Beide liegen falsch, weil Kritik, die ihrem Begriff gerecht wird, schon der Sache nach nicht konstruktiv sein kann, sondern vielmehr eine unerbittliche Analyse des Bestehenden zum Ausgangspunkt nimmt. Kritik zieht ihre Kraft gerade daraus, dass sie frei von jener Heuchelei ist, die Strategen der Konfliktvermeidung und Oberflächenhar-monie für sich nutzen, um diskursive Harmonie vorzugaukeln.
Dass also die an sich notwendige Kritik an Identitätspolitik und Cancel Culture zuletzt sowohl SDP-Politiker Wolfgang Thierse als auch Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht einen so bemäntelten »Shitstorm« einbrachte, liegt weniger darin begründet, dass ihre Analysen besonders originell oder tiefgreifend waren als vielmehr an der Hochempfindlichkeit ihrer validierungs- und denunziationssüchtigen Gegner.
Die mehrheitlich liberalen Gegner der Identitätspolitik schreiben inzwischen ganze Bücher, um beispielsweise die Banalität auszubreiten, dass nicht jeder Weiße ein Rassist ist, was ebenfalls nicht dafür spricht, dass man fähig und willens ist, sich von der intellektuellen Gebrechlichkeit urbaner Twitter-Koryphäen abzuheben. Jüngstes Beispiel für die Indienstnahme trivialer Erkenntnisse ist die Journalistin Judith Sevinç Basad. Ihr im März 2021 beim Westend Verlag erschienenes Buch »Schäm dich!: Wie Ideologinnen und Ideologen bestimmen, was gut und böse ist« avancierte rasch zum Bestseller, was nicht zuletzt daran liegen dürfte, dass Sevinç Basad ebenso stumpfe Losungen ausgibt wie ihre identitätspolitischen Gegner auch. Nur inszeniert sie sich dabei gerne als aufklärerische Instanz – halbgebildetes Zetern gegen die theoriefeindliche Linke und die Verwirrungslust französischer Poststrukturalisten inklusive.
Genauso gern wird der Evolutionsbiologe und Männerrechts-Aktivist Jordan Peterson als schillerndes Gegengewicht zur »woken« Identitätspolitik herangezogen. Marxisten seien die Wegbereiter des identitätspolitischen Irrsinns gewesen, so seine These. Er ignoriert, dass der symbolische Altruismus der identitätspolitischen Linken von Klassen und Besitzverhältnissen schon lang nichts mehr wissen will. Wenn überhaupt, dann soll der sozialen Lage im Gewand des gefühligen »Klassismus« endlich mehr Respekt entgegengebracht werden. So tritt man im Dienste der Minderheiten statt im Namen von Freiheit und Gleichheit auf und betreibt erst recht die ewige Festschreibung von Ungleichheit.
Jordan Peterson selbst stützt seine vielfach widerlegten Theorien auf Existenzialontologie, peppt seine Evolutionspsychologie mit Heidegger auf und bringt Intelligenz mit Genetik in Zusammenhang, sodass in seiner Weltsicht europäische Juden besonders klug und damit anfälliger für marxistischen Terror sind. Persönlichkeitsstörungen hält der Psychologe für nicht behandelbar und bei Depressionen rät er zur heiligen Dreifaltigkeit ‚get a job‘, ‚get new friends‘ und ‚establish a romantic relationship‘. Seine sich auf Logik und gesunden Menschenverstand berufenden Gemeinplätze zur Identitätspolitik zeigen letztlich vor allem eins: Hätte Peterson nicht die richtigen Feinde, wäre ihm wohl nie ein vernünftiges Wort über die Lippen gekommen.
Die liberale Kritik an der Identitätspolitik schweigt geflissentlich über den Umstand, dass die passioniertesten Vertreter der progressiven Hautfarben- und Geschlechtsidentitäts-Folklore eben keine linksradikalen, Marx lesenden Ideologen sind, sondern sich an Spenden und Staatszuwendungen bereichernde Influencer auf Höhe der Zeit, die wie Manager reden und passend dazu den großen Firmen weltweit die neuesten Versatzstücke für ein hippes und aufgeklärtes Renommee liefern. Die Philosophin Nancy Fraser spricht in diesem Zusammenhang zurecht von »progressiven Neoliberalen«.
Mit dem meist von rechter Seite benutzten Begriff des »Kulturmarxismus« hat das ebenso wenig gemein wie mit dem Schlagwort »Wohlstandsverwahrlosung«: Tatsächlich können sich Liberale den Siegeszug der Identitätspolitik nicht anders erklären, denn als Konsequenz einer dekadenten und bevorzugten Generation. Mit Marx wäre dagegen darauf zu insistieren, dass Ideologien (und dazu gehört die linksidentitäre Denkform) keine Verbreitung finden, solange sie nicht objektiv von den Verhältnissen begünstigt werden. Gerade in Zeiten des flexibilisierten, postmodernen Kapitalismus ist die vereinzelte Identität, auf der sich im Gegensatz zur Individualität borniert beharren lässt, die schlechterdings gefragteste Instanz: Auf aufopferungsvollen Einsatz und verspannte Courage verstanden sich schon immer jene Arbeitsapparate am besten, die sich nach getaner Arbeit noch selbst als wandelnde Verdinglichung ihrer angeblichen Identität feilbieten, ob nun als authentische Monade in den sozialen Netzwerken oder als eine der zahllosen dauerlarmoyanten Persönlichkeiten, die Herbert Marcuses Begriff vom »eindimensionalen Menschen« ungeahnte Aktualität verleihen. Mit Radikalität hat Identitätspolitik jedenfalls nichts zu tun: Scheinbar kapitalismuskritischer Lifestyle-Aktivismus und die Stabilisierung kapitalistischer Vergesellschaftung verhalten sich wie Schloss und Schlüssel zueinander.
Als beispielsweise die Proteste der französischen Gelbwesten 2018 ihren Höhepunkt erreichten, reagierten Staat und Polizei mit drakonischen Vergeltungsmaßnahmen, einigen Protestanten wurden mit Gummigeschossen die Augen und andere Körperteile zerstört. Ein solch rigider Eingriff wäre bei Klima-Protesten (oder solchen für symbolische Anerkennung) unvorstellbar gewesen, weil sich diese mit dem Status Quo vertragen und nicht daran erinnern, dass Ausgrenzung aus dem Bildungssektor und dem Wohnungsmarkt nach wie vor in erster Linie durch die soziale Lage stattfindet. Noch immer gilt die Tugend, niedrige Löhne, miese Arbeitsbedingungen und eine mickrige Rente brav zu ertragen. Wer sich dagegen auflehnt, darf nicht mit Gnade rechnen. Unterdessen lobte Merkel ebenso wie Macron die klimabewegten Akteure, und als »Black Lives Matter« auch nach Deutschland schwappte, gemahnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: »Es reicht nicht aus, kein Rassist zu sein. Wir müssen Antirassisten sein«. Allein vor diesem Hintergrund erscheint es geradezu lächerlich, den Bruch zwischen neuer Linker und Marxismus zu ignorieren.
Liberalkonservative und ihre etwas linkeren Ableger feiern die offene Gesellschaft, die den Fortschritt betont, solange er die soziale Frage nicht antastet. Der Gedanke, dass diese Gesellschaft nicht die verwirklichte Vernunft, sondern ein Herrschaftszusammenhang sein könnte, ist ihnen unerträglich. Identitätspolitik ist eine Möglichkeit, auf dieses Unbehagen zu reagieren. Eine ebenfalls in eine Sackgasse führende Alternative ist es, auf dem »sozialen Frieden« zu beharren, der schon immer eine bloße Chimäre war.
Ideologiekritik statt massentauglicher Parolen
Die liberale Kritik begreift Identitätspolitik als Produkt linksradikaler Ideologie und zieht sich auf altbekannte Parolen zurück. Ideologiekritik zeigt dagegen, dass Identitätspolitik ein linksliberales Phänomen ist. Von Nico Hoppe und Sara Rukaj.