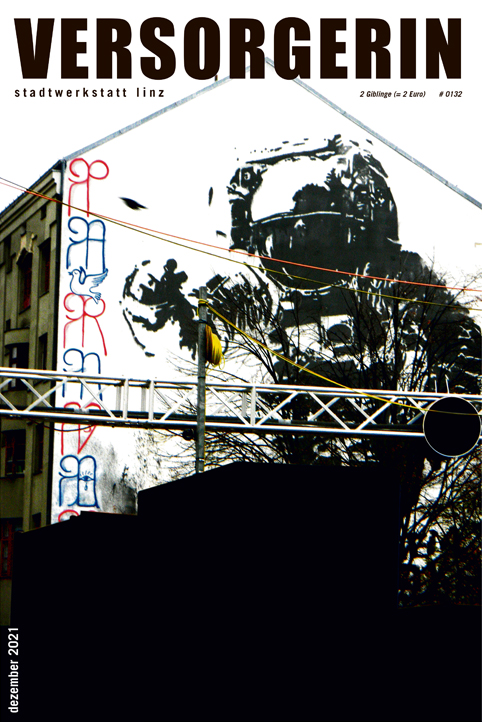In einem Interview, das der französisch-amerikanische Schriftsteller Raymond Federman 1981 mit Stanisław Lem in dessen Haus in Krakau führte, begründete dieser seine Ablehnung der Gattungsbezeichnung »Science-Fiction« mit den Worten: »Der Begriff Science-Fiction hat für mich persönlich etwas Beleidigendes an sich, denn er täuscht eine Verbindung zur Wissenschaft vor, während er in Wirklichkeit nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Viele Jahre lang habe ich Science-Fiction gelesen, in der Hoffnung, in dieser riesigen Menge von Werken etwas Interessantes zu finden. Aber ich habe nichts Interessantes gefunden, und so habe ich vor einigen Jahren ganz aufgehört, mich mit Science-Fiction zu beschäftigen.« Dass Lem, der bis heute standardmäßig als Science-Fiction-Autor rubriziert wird, das Genre als etwas ihm Fremdes beschreibt, aus dem er nicht einmal Anregungen für die eigene Arbeit habe erhalten können, mutet kurios an. Verständlicher wird es angesichts des lebensgeschichtlichen Hintergrunds, der Lem mit Federman verband. Federman, 1928 in Montrouge in der Nähe von Paris geboren, stammte wie Lem aus einer jüdischen Familie. Im Juli 1942 stürmte die französische Polizei im Auftrag der deutschen Besatzungsmacht die Wohnung seiner Familie und durchsuchte sie. Der damals 14-jährige Federman wurde von seiner Mutter im Kleiderschrank versteckt. Federmans Eltern und seine beiden Schwestern wurden deportiert und in Auschwitz ermordet. Er selbst überlebte in wechselnden Verstecken und wanderte 1947 in die Vereinigten Staaten aus, wo er als Jazz-Saxophonist, als Soldat in der US-Army und schließlich als Schriftsteller Auskommen fand.
Der sieben Jahre ältere Lem war Sohn einer polnisch-jüdischen Arztfamilie und studierte in Lemberg bis zu dessen Besatzung durch Deutschland Medizin. Es gelang ihm, seine jüdische Herkunft durch gefälschte Ausweispapiere zu verschleiern, und er arbeitete unter der deutschen Besatzungsmacht als Mechaniker und Schweißer, während er klandestin den polnischen Widerstand unterstützte. Fast alle seine Familienmit-glieder wurden in der Shoah ermordet, und seine Lebensgeschichte blieb auch nach 1945, obwohl er sein Studium wieder aufnehmen und als Journalist arbeiten konnte, geprägt vom auch in Polen weiterhin virulenten Antisemitismus. Dieser wurde nun durch die neuen politischen Spaltungen im Zuge der Blockkonfrontation überlagert. 1945 zog Lem von Lemberg, das nach der Befreiung durch die Rote Armee an die Sowjetunion gefallen war, nach Krakau um, wo er fortan lebte. In seinem frühen, 1955 erschienen Roman »Das Hospital der Verklärung«, der den Lebensalltag von Ärzten und Patienten in einer psychiatrischen Klinik in Polen während der Zeit der deutschen Besatzung schildert, hat Lem zum ersten und letzten Mal die historisch-biographischen Grundlagen seines Schreibens unmittelbar zum Gegenstand der eigenen literarischen Arbeit gemacht. Der Protagonist des Romans, der junge Arzt Stefan Tryziniecki, wird Anfang der 1940er Jahre in der Klinik, in der er arbeitet, Zeuge von Menschenexperimenten, systematischer Euthanasie und sadistischer Folter, die deutsche und kollaborierende polnische Kollegen an Patienten vornehmen, und entwickelt dadurch als anfangs unpolitischer Mensch ein immer schärferes Bewusstsein dafür, dass technologischer und medizinischer Fortschritt nicht nur den Keim zur Verbesserung menschlicher Verhältnisse, sondern auch zu deren Zerstörung in sich tragen.
Als Klinik- und zugleich Entwicklungsroman war »Das Hospital der Verklärung« so etwas wie eine polnisch-jüdische Antwort auf Thomas Manns 1924 erschienenen Roman »Der Zauberberg«, dessen spätbürgerlich-dekadentes Szenario dreißig Jahre später wie das Zeugnis einer völlig anderen Epoche anmutete. Weil er bei der Arbeit daran selber merkte, dass der bürgerliche Bildungsroman sich für den Ausdruck der historischen Erfahrung, die sein Gegenstand war, nicht eignete, griff Lem fortan auf Formen der Trivialliteratur zurück, mit denen er schon zuvor experimentiert hatte. In seinen frühen Groschenromanen »Der Mann vom Mars« (1946) und »Der Planet des Todes« (1951) hatte er sich bereits darin geübt, Erzählformen der utopischen und dystopischen Literatur zu adaptieren. Die nicht wissenschaftlich oder metaphysisch begründete, sondern kindlich-experimentelle Freude an der Astronautik, von der diese frühen Bücher geprägt sind, hat Lem seither bewahrt und zur Quelle eines Schreibens gemacht, das sich mit den tradierten Begriffen der hohen und populären Literatur nicht angemessen beschreiben lässt. Vor allem deshalb nicht, weil Lem das spielerische, gleichsam kindliche Moment seines Schreibens stets mit einem tiefen, historisch begründeten Ernst vermittelt hat.
Am deutlichsten wird das an seinem 1961 erschienenen, vielfach verfilmten Roman »Solaris«, worin Elemente der aus Lems Anfängen vertrauten Weltraum-Kolportage für eine Reflexion der Problematik von Gedächtnis und Vergessen in der damaligen Gegenwart genutzt werden. Der Planet Solaris, von dessen Erforschung der Roman in vielfach miteinander verschränkten Zeit- und Handlungsebenen erzählt, wird von einer anscheinend lebendigen und vernunftbegabten Substanz belebt, einem riesigen Ozean, der aus sich selbst heraus verschiedenste Wesen und Nachbildungen früher lebender Menschen hervorzubringen vermag. In den menschlichen Reinkarnationen, die er erzeugt, scheinen sich verdrängte Schuldgefühle, vergessene Untaten und verschüttete historische Ereignisse der Menschheitsgeschichte zu verkörpern. Der Protagonist Kris Kelvin, der eine Forschungsstation auf Solaris inspiziert und dort solchen Reinkarnationen begegnet, trifft unter ihnen auch eine Wiederverkörperung seiner verstorbenen Freundin Haley. Unmenschlich-menschlich, wie sie ist, zeigt sie sich zur Selbsterkenntnis und Reflexion ihrer selbst als Nachbildung fähig und hegt den Plan, die Welt der posthumanen Wiedergänger, die Solaris beleben, zu zerstören. Kelvin stellt sich ihrem Vorhaben zunächst in den Weg, lässt sie aber schließlich bei dem Versuch der Selbstzerstörung der Replikanten gewähren.
Obwohl »Solaris« gegenüber dem historischen Realismus von »Das Hospital der Verklärung« eine Rückkehr zu Lems trivialliterarisch inspirierten Anfängen bedeutete, werden diese in dem Roman ebenso überschritten wie die Formen des erzählerischen Realismus. »Solaris« lässt sich als fiktionale Reflexion von Gedankenfiguren der idealistischen und materialistischen Philosophie lesen – als Parabel auf den widersprüchlichen und zugleich notwendigen Zusammenhang zwischen Substanz und Erscheinung, Sein und Schein, Materie und Geist. Zugleich bleibt das Buch unverständlich, wenn es nicht bezogen wird auf die historischen Erfahrungen, die es in sich aufgenommen hat, ohne sie zu thematisieren: Der Planet Solaris ist nicht einfach eine dem menschlichen Geist inkommensurable Erscheinungsform kosmischen Lebens, sondern in dieser Inkommensurabilität drückt sich selbst Menschliches aus, das einen zeitgeschichtlichen Index hat. So sehr ist die Geschichte der menschlichen Zivilisation zugleich eine der Selbstverstümmelung, der Selbstverleugnung und wechselseitigen Knechtung der Menschen, dass diese ihr akkumuliertes schlechtes Gewissen, ihre Lebenslügen und schon zu Lebzeiten begrabenen Hoffnungen gleichsam externalisieren, aus der Menschheit ausschließen und anderswo anhäufen müssen. Der Planet Solaris figuriert insofern als Ozean des verdrängten und ins historische Unbewusste herabgesunkenen Wissens der Menschen um die Tatsache, dass sie ihren eigenen Begriff tagtäglich verraten und korrumpieren. Das Unheimliche der Replikanten, die Solaris bevölkern, besteht in dieser vertrauten Unvertrautheit.
Ob Haleys Vorhaben, das Zerstörerische, das sie in sich selbst als einer Wiedergängerin des verdrängten Menschlichen entdeckt, zum Verschwinden zu bringen, als Potenzierung der Barbarei oder als Möglichkeit einer Selbstzivilisierung der Menschen aufgefasst wird, bleibt bei Lem im Unklaren. Seine phantastischen Romane, von den 1957 erschienenen »Sterntagebüchern« bis zu dem späten Roman »Fiasko« (1987), sind geprägt durch diese doppelte Verweigerung sowohl gegenüber dem Genre der Utopie wie der Dystopie. Dass Lems Serienprotagonisten, wie die vielfach begegnenden Astronauten Ijon Tichy und Pirx, literaturhistorisch der Tradition des Schelms und Narren entspringen, verweist auf diese Doppeldeutigkeit. Leitfigur des utopischen Science-Fiction, einer fortschritts- und technikoptimistischen Gattung, ist der Raumfahrer als neue Form des Naturbeherrschers, Erkunders und Ingenieurs, der die Möglichkeiten des Menschen über seinen terrestrischen Einflusskreis hinaus erweitert und dadurch wiederum den Menschen nützt. Leitfigur der Dystopie ist der finstere Abenteurer, der in der Fremde, die er erkundet, seinen eigenen Schattenseiten, Ängsten und zurückgestauten Trieben begegnet, die in der phantastischen Welt entfesselt statt zivilisiert werden. Der Schelm ist demgegenüber eine Schwellenfigur: Er verbindet den kindlichen Optimismus des Entdeckers mit der Düsternis des Abenteurers, der mit den eigenen Grenzen und Abgründen konfrontiert wird. Er ist weder Optimist noch Existentialist, sondern Zweifler und Ironiker.
Von Ironie lässt sich bei Lem indessen nur im Sinne der frühromantischen Ironie sprechen, deren Selbstdistanzierung und Selbstrelativierung kein leeres Spiel, sondern Ernst und eben dadurch überhaupt erst ein Spiel im Wortsinn ist. Seine Astronauten und Raumfahrer verbindet mit den Detektivfiguren seiner Kriminalromane, die die Gattung des Whodunit in ähnlicher Weise negieren und erneuern wie seine phantastischen Romane den Science-Fiction, dass ihre Ermittlungsarbeit auf eine Erkenntnis hinausläuft, die den Erkenntnisbegriff der positiven Wissenschaften übersteigt, ohne deshalb bloße Spekulation oder Metaphysik zu sein. Lems erster, 1958 entstandener Kriminalroman »Die Untersuchung« handelt von mysteriösen Ereignissen auf englischen Friedhöfen, wo der Reihe nach Leichen verschwinden, die an anderen Orten wiederauftauchen. »Der Schnupfen«, 16 Jahre später veröffentlicht, erzählt von einer Serie unerklärlicher Todesfälle in Italien, wo eine Reihe von Touristen, die allesamt allergische Vorerkrankungen hatten, an einer unbekannten Krankheit zu sterben scheinen. In beiden Romanen ist bis zum Schluss unklar, ob überhaupt Straftaten vorliegen, und in beiden führen die Ermittlungsarbeiten der Behörden in ein unentwirrbares Durcheinander von Korrelationen, Zufällen, Vermutungen, statistischen Spekulationen und Hypothesen, aus denen es am Ende kein Entkommen mehr gibt. Der Versuch der Aufklärung potenziert das Rätsel gerade dadurch, dass er auf alle möglichen Teilfragen Antworten bietet, die einander allesamt widersprechen und die Zweifel daran verstärken, ob es überhaupt ein Rätsel gibt.
Dass Lem sich in allem, was er geschrieben hat, sowohl geweigert hat, den Aufklärungsversprechen der modernen Wissenschaften Vertrauen zu schenken, wie auch ihren aufklärungsfeindlichen Gegnern Recht zu geben, zeugt von einer reflektierten kindlichen und dadurch erwachsenen Skepsis gegenüber der Möglichkeit positiver Erkenntnis überhaupt. Den historischen Erfahrungsgrund dieser Skepsis hat er in »Das Hospital der Verklärung« ausbuchstabiert: das Selbstdementi der Wissenschaften des Menschen im Angesicht des Verrats der Menschheit an ihrem eigenen Begriff. Indem er seit diesem frühen Buch zumindest in seiner Rolle als Autor kaum je mehr über diesen Erfahrungsgrund gesprochen hat, hat er ihn dennoch zur Geltung gebracht: Das Schweigen spricht von dem, wovon es schweigt. Wo dieser Zusammenhang nicht gegenwärtig ist, wird Lems phantastische Literatur um ihren realistischen Kern gebracht und dadurch wirklich zum leeren Spiel.
Phantastischer Realismus
Stanisław Lem, dessen 100. Geburtstag dieses Jahr begangen wurde, hat sich stets gegen die Unterstellung verwahrt, er schreibe Science-Fiction. Was diese Verweigerung mit seiner jüdischen Erfahrung zu tun hat, erläutert Magnus Klaue.