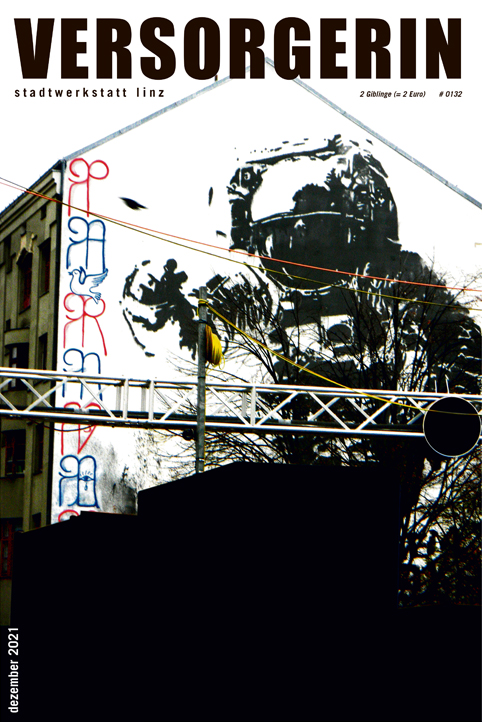DIE TÜR UNSERES Kinderzimmers stand weit offen. Hörten wir ein Schluchzen, gingen wir hinunter ins Wohnzimmer und setzten uns ans Kopfende des Sofas. Wir streichelten Mutters Stirn, das strohblonde Haar, befühlten den Abdruck, den das Kreuzstichmuster des Polsters auf der Wange hinterlassen hatte. Drehte sich Mutter auf den Bauch, streichelten wir den Rücken, fuhren mit der Handfläche über die weit vorstehenden Schulterblätter, zählten die Rippen. Zweimal zwölf. Wir sagten Mutter, dass wir sie lieben. Es war nicht wahr. Wir wollten nichts sagen, sie nicht berühren, nicht alleine mit ihr sein. Vater arbeitete bis in die Abendstunden und unsere Schwester blieb nach dem Unterricht zumeist noch in der Stadt: Schachtraining, Freifach Musik, Vorbereitungskurs zur Mathematik-Olympiade. Wir gingen in die Volksschule, waren mittags wieder daheim.
ES GAB FOTOS, auf denen wir glücklich aussahen: im Maradona-Trikot hinter einer rosaroten Torte, beim Martinsfest von Laternen und Anoraks umringt, mit Flossen an den Füßen in der Sandkiste, Hand in Hand mit Vater vor einem verschneiten Büffelgehege.
Vater war beinahe zwei Meter groß. Für gewöhnlich hielt er sich weit vorgebeugt und zog seinen kahlen Kopf ein. Auf dem Foto sah er so groß aus, wie er wirklich war. Er steht aufrecht in der Winterlandschaft und trägt eine riesige Fellmütze.
Mutter war fünfmal in der geschlossenen Abteilung. Dort schluckte sie Neuroleptika mit ungesüßtem Früchtetee. Dort band man sie fest und jagte Stromschläge durch ihren Körper.
AUF DEM SERVIERWAGEN, den der Pfleger durch den Korridor schob, stapelten sich weiße Untertassen. Mutter trug ihren Morgenmantel über einem ausgewaschenen Nachthemd und starrte auf den Becher in ihrer Hand. Vater klopfte mit dem Zeigefinger auf die Stuhllehne. Unsere Schwester ordnete die Ziersternchen, die auf der Tischdecke lagen, zu einer Linie an. Der Pfleger fuhr mit dem Servierwagen über eine Aluminiumleiste. Es klimperte. Es klimperte noch einmal. Über dem Tisch hing ein Tannenzweig, daran ein hölzerner Engel mit roter Schleife.
»Hier ist es schön geschmückt«, sagten wir.
In der Glastür am Ende des Ganges erschien eine dürre Greisin, holte Luft und schrie: »Verschissen ist der rote Gott, verschissen ist der Führer, verflucht und verschissen!«
Hinter ihr wurde eine Stimme laut: »Frau Gattringer!«
»Luzifer soll alles holen, was sich regt!«, kreischte die alte Frau, während sie ein Pfleger von der Tür wegzerrte.
»Alles, was irgendwann gelebt hat, das gehört ihm schon!«
Die Glastür fiel zu.
WIR MALTEN MIT Filzstiften Monster in unlinierte Schulhefte und gaben den Monstern Namen. In unseren Bildern verschmolzen verschiedene Tiere miteinander und menschliche Figuren bekamen groteske Körperteile: dornenbesetzte Tentakel, Hufe und Reißzähne, zwei Bärenköpfe, Pranken aus Feuer, Mondsteinhaut, Skelettflügel, Schlangen anstatt von Armen, dreizehn Hörner auf einem Nackenschild aus Stahl. All unseren Monstern fehlte der Hals. Ihre Augen saßen auf Höhe ihrer Schultern.
»Stammen die alle von der Schildkröte ab?«, fragte Vater, als er eines unserer Hefte durchblätterte.
Er schmunzelte. Wir senkten den Kopf. Vater schlug die nächste
Seite auf.
»Ah, ein Drache«, sagte er und deutete auf die Bibel, die offen neben ihm lag. »Da kommt auch ein Drache vor.«
Vater gab uns das Heft zurück, steckte sich eine Zigarette in den Mundwinkel und zog sein Sturmfeuerzeug aus der Hosentasche.
»Hatte Jesus einen Drachen?«, fragten wir.
(...)
UNSERE SCHWESTER HOCKTE auf dem Teppich im Wohnzimmer und breitete Frischhaltefolie vor sich aus. Auf die Folie legte sie einen Kreis aus Zuckerln. Danach steckte sie sich ein Zuckerl nach dem anderen in den Mund, abwechselnd ein gelbes und ein oranges. Wir taten es ihr gleich: gelb, orange, gelb, orange, orange.
»Falsch«, sagte unsere Schwester mit prall gefüllten Backen.
Wir lachten, warfen den Kopf in den Nacken, ein Zuckerl rutschte in die Luftröhre. Wir rissen die Augen auf, rangen nach Atem, beugten uns vor, die übrigen Zuckerl fielen uns aus dem Mund. Erst dachte unsere Schwester, wir würden nur Spaß machen, schließlich aber begann sie uns auf den Rücken zu schlagen, anfangs zögerlich, dann schmerzhaft fest. Wir erbrachen auf den Teppich.
»Alles ist gut«, sagte unsere Schwester, sprang auf, schleifte den Teppich über das Parkett und zerrte ihn vor die Haustür.
Danach ging sie in den Keller und ließ uns ein Bad ein. Sie prüfte die Temperatur des Wassers, wir mussten uns in die Wanne legen.
»Ich mache Kakao«, sagte unsere Schwester und verschwand nach oben.
Ein paar Minuten später gab es einen Stromausfall. Mit einem Mal lagen wir in völliger Dunkelheit. Von nun an wollten wir immer ohne Licht baden. Manchmal ließen wir ein Teelicht flackern.
»Deine Schwester kann schon auf sich selbst aufpassen, aber noch nicht auf dich«, sagte Vater am Abend.
Wenn Mutter in der Klinik bleiben und Vater arbeiten musste, brauchte es von nun an immer einen Erwachsenen, der nach der Schule auf uns aufpasste: unsere Tante oder die Nachbarin. War schulfrei, brachte Vater uns zu seiner Mutter. Unsere Schwester weigerte sich bei der Aschbach-Großmutter zu übernachten. Sie ekelte sich vor den fetten Fleischfliegen in der Stube und fand, dass die Bettwäsche nach Kuhfladen stank. Manchmal nahm sich Vater Urlaub. Er konnte nichts kochen außer Frankfurter.
VATER SETZTE UNS mit einer Sporttasche voller Gewand in Aschbach ab. Großmutter winkte Vaters Auto nach, der Kater schnupperte an unseren Schuhen. Der Boden im Hof war gesprenkelt mit Hühnerkot, vor der Stallmauer wölbten sich Inseln aus hart gewordenem Schnee. In der Stube goss uns Großmutter einen Löffel Ribiselmarmelade mit kaltem Wasser auf und schenkte sich ein großes Glas Most ein. Das Gulasch auf dem Herd schlug Blasen. Die Hauptspeise wurde aus demselben Teller gegessen wie die Suppe davor und der Grießkoch danach. Am Abend schaute uns Großmutter beim Zeichnen zu, schlief im Sitzen ein, erwachte wieder, füllte ihr Glas auf und erzählte. Früher hatten zum Haus Getreidefelder gehört und der Stall war voller Tiere gewesen. Heute war der Misthaufen seinen Namen nicht mehr wert. Unser Onkel, Vaters jüngerer Bruder, hatte nach Großvaters Tod den Betrieb übernommen, aber bald genug von der Landwirtschaft gehabt, und war mit seiner Frau in die Schweiz ausgewandert. Ein paar Kühe und die Hühner hatte sich Großmutter behalten. Sie brauchte etwas Leben um sich herum. Nur drei ihrer Kinder hatten das Erwachsenenalter erreicht. Die anderen drei waren jung gestorben. Eines hatte den Schlitten über den gefrorenen Tümpel gezogen und war ins Eis eingebrochen, eines hatte verdorbene Würste gegessen, eines war behindert zur Welt gekommen und in der Nacht nach seiner Taufe nicht mehr aufgewacht.
(...)
»Das heißt nicht Plüschiater«, sagte die Aschbach-Großmutter.
Sie schlug die Sohlen unserer Winterschuhe gegeneinander, Schneekristalle spritzten auf ihren Kittel, es hallte im Hof.
»Das heißt Psychiater«, sagte sie und entfernte mit ihren gelben Fingernägeln Labkrautsamen aus den Klettverschlüssen. »Und davon gibt es schon genug auf der Welt. Willst du nicht lieber Pfarrer werden?«
Die alte Laterne schwankte. Der Wind beugte die Wipfel der beiden Kastanienbäume und drückte die Flügel des Hoftores auf. Wir schauten hinaus in die Düsternis. Wir warteten darauf, dass mit einem Mal die Hügel zerreißen, dass ein Feuerturm aus dem gefrorenen Ackerboden bricht und den Nachthimmel erleuchtet, in weiten Bögen Gestein in die Bäche geschleudert wird, während sich ein Drache aus den Schatten vor uns löst und das Wort an uns richtet, ein Drache, groß und feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Die Wolkendecke
knisterte.
»Morgen kommt Mutter wieder heim«, sagte Vater am Telefon. »Nach dem Frühstück hole ich dich ab und dann fahren wir gemeinsam zu ihr. Geht es dir gut?«
Großmutter zwängte ihr offenes Bein in eine braune Stützstrumpfhose. Der Kater schärfte seine Krallen an einem Holzscheit. Die Gasflammen des Herdes zischten.
»Ja.«
In der Nacht schlichen wir in die Stube, nippten am Most, spuckten aus, naschten vom Rhabarberkuchen und malten bei Kerzenschein Monster in unser Heimatkundeheft: eine Riesenspinne, ein Gespenst mit neun Herzen und zuletzt einen Kampfroboter, der brennende Fische abfeuern kann. Hatten wir ein Monster fertiggemalt, schrieben wir seinen Namen über das Bild: Oktama, Egonil, KRX-2000. Unter dem Bild notierten wir, wo das Monster zu finden ist: Rattenhaus, Kalter Urwald, Galaxis. Wir bliesen die Kerze aus und beobachteten, wie der Rauch vom Docht aufstieg, sich kräuselte, breiter wurde, verblasste.
Auf dem Weg zurück in unser Zimmer wollten wir mit dem Fuß ein welkes Blatt zur Seite wischen, das mitten auf dem Gang lag. Doch als wir es anstießen, löste sich ein Ärmchen aus dem dunklen Fleck und ein kleiner Flügel spannte sich auf. Uns entfuhr ein Schrei, wir zogen den Fuß zurück. Die Fledermaus hob ein wenig ihren Kopf. Ihr blieb nicht mehr viel Zeit. In wenigen Sekunden würde das Licht angehen, die Schlafzimmertür sich öffnen und die Großmutter den Reisigbesen aus der Küche holen.
»Ihr habt mir so gefehlt«, sagte Mutter, stellte ihren Koffer auf dem Asphalt ab, ging in die Hocke, schloss erst unsere Schwester, danach uns in ihre Arme. In einer Pfütze des Parkplatzes spiegelte sich eine Wolke, die wie ein Einhorn aussah. Wir blickten hoch, Mutter drückte unseren Kopf zurück an ihre knochige Schulter.
»Ihr habt mir so gefehlt.«
(...)
Aus: Stephan Roiss, Triceratops, Verlag Kremay & Scheriau, Wien 2020, Seiten: 9-12 & 15-19