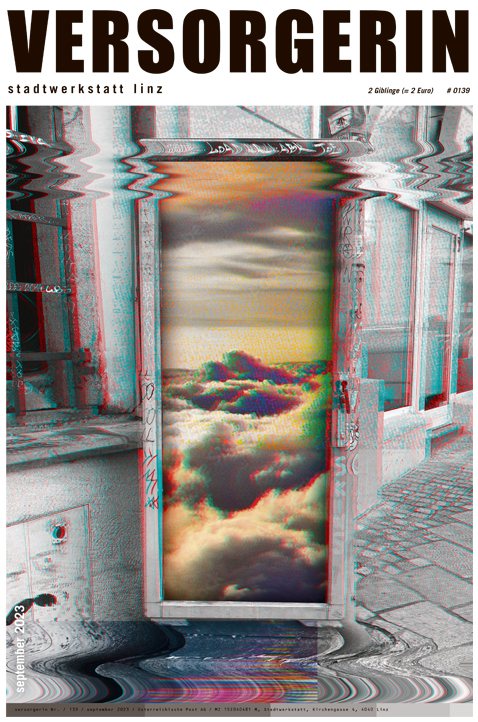»Der Orientalismus verfügt über kein Wesen, Orientalismus fehlt eine These. Soweit das Buch eine These hat, ist es unvermeidlich eine über das Wesen des Orientalismus. Falls dem so ist, dann unterschreibt Said einen doktrinären Essentialismus.« (Irfan Khawaja)
»Said had a good point, but didn’t make a good point.« (Bernard Lewis)
Auf unserer Reise zu den geheimen Tempeln des ignorierten Wissens über das Verhältnis des neuzeitlichen Westens zum Rest der Welt machen wir diesmal in einer diskursbestimmenden Oase Halt, in der große Expertise entwickelt wurde, Reisende auf viele richtige und noch mehr falsche Fährten zu locken. Der lokale Oasengreißler Edward Said verkaufte dort zeitlebens ein kartografisches Werk namens Orientalismusdiskurs, das sich noch immer großer Beliebtheit erfreut. Nicht lange werden wir uns hier aufhalten, denn die Karawane muss bald weiterziehen, ihr Ziel ist der Kulturrelativismus, wo sich uns unser Cicerone, Lord Byron, wieder anschließen wird, der aus einem für ihn typischen kindlichen Trotz heraus einen Bogen um die Oase machte. Warum? Nicht etwa, weil Said ihn in seinem weltberühmten Buch Orientalismus als orientalistischen Buhmann markierte, sondern weil Said ihn nicht gelesen hatte.
Dieser musste wegen seines Werks einen dermaßen heftigen akademischen Spießrutenlauf erfahren, dass man beinahe zu seiner Verteidigung schreiten möchte. Immerhin hat er die notwendige Kritik der Essenzialisierung des Orients in Hinblick auf koloniale Praxis, koloniales Denken und westliche Definitionsmacht angestoßen. Es gelang ihm, wovon so viele grauen Mäuse an der Diskursfront nur träumen können: sich in die Debatte unumstößlich als Stele hineingerammt zu haben, an welcher man nunmehr nicht mehr vorbeikam, ganz gleich ob man mit der Axt darauf einschlagen oder Blumen davor niederlegen wollte. Unglücklicherweise hat Said notwendige Kritik in Bahnen gelenkt, um die sich heute bunte intellektuelle Basare der kognitiven Verzerrung gruppieren, wo die Einwände gegen seine Inkonsistenzen und Verallgemeinerungen als westliches, »weißes« Herrschaftswissen diffamiert werden, und – so sie von Menschen mit morgenländischen Namen stammen – als postkoloniale Komplizenschaft. In gröbster Kürze seien hier die eklatantesten Einwände gegen Said zusammengefasst, denn der Karawanenführer ruft bereits zum Aufbruch.1 Ich werde von meiner Seite noch ein paar Kritikpunkte beisteuern, die – ich weiß es nicht – möglicherweise längst formuliert wurden.
Saids Kritik des Orientalismus schien mir nicht bloß Essenzialisierung des Okzidents zu betreiben und auch die von ihm kritisierte Essenzialisierung des Orients zu verstetigen, sondern vielmehr selbst ein durch und durch eurozentrischer Diskurs zu sein.
Said behauptet, die Beziehung zwischen Okzident und Orient sei »eine der Macht, der Beherrschung und der Hegemonie«, der Orient fungiere als das konstitutive negative Andere, aus dem das westliche Selbstverständnis seine Suprematie ableite.

Als imperialistische Roadmap eher unbrauchbar: »Femmes d‘Alger dans leur appartement« von Eugène Delacroix (1834) (Bild: Public Domain)
Die zentralen Vorwürfe gegen sein Werk belaufen sich darauf, dass er aus einem Gros von über 60.000 Werken zu Islam und Orient selektiv jene herausgeklaubt habe, die seine Thesen bestätigten, währenddessen die westlichen Diskurse über den Orient eine weitaus größere Vielfalt, gegenseitige Korrigierbarkeit und Selbstreflexion aufwiesen, als es Said glauben machen wollte. Weiters, dass er den Orientalismus als einen in Zeit und Raum konstanten Diskurs der Essenzialisierung des Orients postulierte, ihm somit ein Wesen zusprach. Damit aber essenzialisierte er nicht nur den Orientalismus selbst, sondern den gesamten Okzident als konstanten Träger einer konstanten Disposition. Folglich sprechen manche Kritiker von Okzidentalismus (vor dem Said in seinem Buch warnt und den er doch permanent reproduziert). Bemerkenswert war der postmoderne Rückfall in den philosophischen Idealismus – Said sprach den Orientdiskursen eine politische Wirkmacht zu, als hätten die Briten nach dem Ersten Weltkrieg den Irak nicht wegen geostrategischem und ökonomischem Kalkül zu ihrem Protektorat gemacht, sondern weil sie zu viel Aischylos, Dante oder Sir Richard Burton gelesen hätten. Zwar leugnet Said eine unmittelbare Kausalität zwischen Imperialismus und Orientalismus, doch spricht er davon, letzterer »zementiere« ersteren. Ein zentraler Einwand gegen Saids Generalhomogenisierung weist das Postulat zurück, die Orientalistik sei stets Instrument und Ausdruck des Imperialismus gewesen. Dies ist vor allem für die richtungsweisende deutsche Orientalistik nicht haltbar, die im Gegensatz zu Frankreich und England bis Ende des 19. Jahrhunderts gar nie in die Verlegenheit kam, staatlichen Kolonialambitionen zu dienen (und sich zudem durch eine auffällig orientophile Tendenz auszeichnete).
Said war Literaturwissenschaftler und Diskurskritiker, folglich fängt bei ihm der Imperialismus beim Herrschaftsakt der Beschreibung an. Wie aber die von ihm mehr beschriebenen denn analysierten künstlerischen Orientalismen des 19. Jahrhunderts (in Dichtung wie in Malerei Ausdruck antiwestlicher Weltflucht) zum epistemischen Zement des Imperialismus werden konnten, ohne darin zu versinken, bleibt ein Rätsel. Die projektiven Chimären orientalischer Haremswelten dienten dem Imperialismus bestimmt nicht als Masterpläne der Unterwerfung, und die Karten für die Annexion Algeriens wurden weder von den Malern Eugène Delacroix noch von Jean-Auguste-Dominique Ingres angefertigt. So Wissen über den Orient politischer Einflussnahme dienstbar gemacht wurde, erforderte es ein gewisses Maß an Sachlichkeit und Akkuratesse. Said-Kritiker Fred Halliday fand dafür ein anschauliches Bild: »Wenn man eine Bank ausrauben will, ist man gut beraten, sich einen möglichst genauen Plan dieser Bank zu besorgen.«
Die k. u. k. Konsuln im nordalbanischen Shkodra in der Periode von 1860 bis 1914 etwa waren über die Ethnographie der Bergstämme genau informiert, fungierten sie doch als Agenten der österreichischen Einflussnahme und der Habsburger Protektion der katholischen Albaner im Osmanischen Reich. Die Franzosen und Briten konnten es sich bei ihrer Manipulation der Hohen Pforte gar nicht leisten, das von Said dem Orientalismus unterstellte Bild eines statischen, zurückgebliebenen und ahistorischen Orients zu pflegen, und mussten der eigenmächtigen Modernisierung Ägyptens, das unter dem autonomen Gouverneur Muhammad Ali Pascha (ca. 1770–1849) den westlichen Markt mit billiger Baumwolle flutete, ebenso Rechnung tragen wie den Säkularisierungstendenzen der Tanzimat-Reformen in Istanbul.
Said tappte in die Widerspruchsfalle, welche der diskurskritische Konstruktivismus sich selbst zu stellen pflegt. Da er sich sowohl von Adorno als auch Foucault beeinflusst sah, schienen bei ihm Ideologie- und Diskurskritik zu kollidieren. Einerseits monierte er an etlichen Stellen, dass der Westen den Orient falsch, vorurteilsvoll und interessegeleitet beschrieben habe, ebenso oft stellte er aber seine Prämissen aus, dass es weder einen richtigen Orient noch vorurteils- und interesseloses Wissen gebe.
Die Authentizitätsfalle führt ihn in den nächsten Selbstwiderspruch: Der Orient, der angeblich ein westliches Konstrukt sei, müsse sich selbst definieren. Wie kann sich etwas selbst definieren, das eine fremde Zuschreibung ist, ohne diese diskursive Manschette zu reproduzieren? Nicht nur der Orientalismus, auch Orient und Okzident scheinen bei ihm wesenhaft zu sein. Überall wo Said Essenzialismus dingfest machen wollte, füllten sich seine Fußstapfen mit neuen Essenzialismen.
Die ganze Welt ist Okzident
Was für Herausforderung wäre es, die Kausalitäten, Konvergenzen und Synergien von Rassismus, Exotismus, Macht und kolonialer Unterwerfung bis in die kleinsten Verästelungen ihrer Widersprüche zu kartographieren, und anstatt idealistische oder materialistische Positionen einer überkomplexen Geschichte aufzuzwängen, genau zu untersuchen, wie Diskurs und materielle Welt einander durchdrangen.2 Das freilich kann eine moralisierte Orient-Okzident-Polarität nicht leisten. Vielleicht war es Edward Said, der als Erster einen astreinen Diskurs im Foucault’schen Sinn entworfen hat, in dessen hermetische und selbstreferenzielle Struktur sich einschrieb, was gesagt werden darf und wer es sagen darf. Die Objekte des Diskurses, »Orientalen« und andere Indigene und Kolonialisierte, erheben in weitaus geringerem Ausmaß Einspruch gegen ihn als – wie Said selbst – akademisierte Vollstrecker eines westlichen Selbsthasses, deren gesamtes methodisches Werkzeug samt Bezugsrahmen eurozentrischer ist als alle orientalisierenden Schwelgereien aus den Federn Wordsworths, Chateaubriands oder Byrons. Zumindest gehorcht die Orientalismus-kritik eher den Kriterien eines Diskurses, als das, was sie zu kritisieren vorgibt: den Orientalismus.
Der Orientalismus ist wie seine vielen postkolonialen Kinder ein Wespennest aus Tautologien und Doublebinds. So soll er ein seit der Antike intaktes System der Konstruktion und Abwertung des Orients vorstellen. Doch auch wer versuchte, den Orient zu idealisieren, entkam nicht dem Verdikt, denn er erdrosselte orientalische Realität mit den Gazeschleiern seiner Projektionen. Wer sich aber einbildete, diese orientalische Realität angemessen realistisch darstellen zu können, beging das größte protokoloniale Verbrechen, denn besagte Realität wäre ja Said zufolge wahlweise und auf magische Weise zugleich diskursive Fata Morgana und fassbare Wesenhaftigkeit, sofern sie von autochthonen Teilhabern beschrieben werde. Wer den Orient offen und ehrlich abwertet, ist ein zuverlässiger Kandidat für Orientalismus und kommt noch am besten davon; wer aber meint, dieser werde als westliches Identitätsfundament überschätzt und der Orient sei im Zeitalter der Aufklärung schon lange nicht mehr so bedrohlich gewesen, um Konstituante westlicher Selbstgewissheit zu sein, wertet ihn gleichfalls ab, weil er ihn nicht ernst genug nimmt, und ist folglich Spitzenkanditat für Orientalismus. Sucht jemand nach einer analytischen Pointe dieses Zirkels, wird er nicht mehr dabei herausfinden, als dass der Westen dumm und böse ist, von Kolonialismus und Rassismus aber wenig erfahren. Said, ein an Kritischer Theorie und westlicher Literatur geschulter New Yorker, wurde im Libanon geboren, in einer Region, die nicht wie Algerien unmittelbare französische Kolonie, sondern wie Syrien nach dem Ende der 500-jährigen osmanischen Kolonialherrschaft französisches Mandatsgebiet war, und von allen je kolonialisierten Territorien wohl den wenigsten westlichen Chauvinismus erlebte. Orientalismuskritik ist wie viele ihrer postkolonialen Kinder zutiefst eurozentristisch, weniger, weil ihre Vertreter, gleich ob sie genuine Westler oder westlich gebildete Orientalen sind, ihre Kritik westlicher Wissenssysteme mit den Kategorien westlicher Wissenssysteme formulieren, und mit eben diesen von Nichteuropa die Stärkung autochthoner Wissenssysteme fordern, nein, sie ist vor allem eurozentristisch, weil selbst in der schärfsten Kritik Europa der übermächtige Referenzpol bleibt, demgegenüber der Rest der Welt sich lediglich als epistemisches Opfer, als Objekt verhält. Die Kritik des Orientalismus löst den Orientalismus quasi darin ab, den Orient zu objektivieren. Die Einwohner dieses ominösen Orients figurieren nicht als Opfer von Ölpreisschwankungen, neokolonialer Wirtschaftserpressung oder der eigenen religiösen wie säkularen Eliten, sondern als perennierende Opfer von Goethe, Flaubert und Massignon.
Es gibt nichts Nichtwestliches mehr. Der bretonische Nativismus ist ebenso eine Reaktion auf westliche Moderne wie der iranische Islamismus, und die Homophobie, glaubt man den Thesen des postkolonial argumentierenden Foucaultadepten Georg Klauda,3 ebenso ein westlicher Import wie die Technologie des Elektroschockers, mit dem man Schwule im Iran und in Uganda foltert.
Wie sehr sich die Kritik des Westens selbst eurozentrisch auf die Zehen steigt, lässt sich an zwei Beispielen verdeutlichen: Wenn ein mittelalterlicher Gelehrter wie Ibn Sina als schillernder Vertreter muslimischer Diskursivität gepriesen wird, dann oftmals wegen seiner angeblichen Säkularität. Dies impliziert aber, dass diese einem totalen religiösen Weltbild überlegen sei und Ibn Sina nicht wegen seiner islamischen Identität, sondern wegen deren Überwindung so faszinierend sei. Oder: Ist die Grausamkeit von Conquistadores und Siedlern gegen oft nicht minder grausame Indigene so verwerflich, weil sie Ausdruck ihrer zivilisatorischen oder christlichen Ethik war oder weil die Grausamen heuchlerisch gegen diese verstießen. Letztere Option funktioniert nicht ohne implizite Parteinahme für diese Ethiken. Der Rückgriff auf die alte, aber fristlos entlassene Ideologiekritik ließe dieses Problem in Minutenschnelle lösen. Viele indigene, post- und dekoloniale Anfechtungen des Eurozentrismus bauen auf europäischen Kategorien, die wütenden Schreie des Ostens hallen an den Wänden westlicher Kategorieruinen wider.
Steifzüge in antiorientalistische Vergangenheiten
Edward Said zufolge ließe sich ein westlicher Überlegenheitsdiskurs bis zu Aischylos (Perser!), ja sogar Homer (Trojaner!) zurückverfolgen. Die griechischen Stadtstaaten der Antike wussten freilich noch nicht, dass sie der Westen sind. Bis zur Bedrohung durch das Persische Großreich im 5. Jahrhundert v. u. Z. waren sich die diversen griechisch-sprachigen Communities ihres eigenen peripheren Charakters am geographischen wie zivilisatorischen Rand orientalischer Hochkulturen durchaus bewusst. Stadtstaaten leiteten ihre Genealogien von ägyptischen oder vorderorientalischen Kulturheroen ab. (So wie später englische und französische Könige des Hochmittelalters ihre Ahnenlinien auf die orientalischen Stämme des Alten Testaments – Ham, Sem etc. – zurückführten.)
Das änderte sich mit den Siegen über die Perser. Das Othering der Perser, frühe Diskurse persischer Dekadenz versus hellenischer Sittenstrenge, lassen sich schwer als imperialistische Ideologeme bezeichnen, in Anbetracht des Umstandes, dass zu dieser Zeitenwende die untereinander verfeindeten griechischen Stadtstaaten als »gallische Dörfer« die Rolle der antiimperialistischen Résistance gegen ein aggressives Großreich usurpierten. Als Diakritikum strichen die griechischen Ideologen den Unterschied zwischen ihren demokratischen Verfassungen („Keines Menschen Sklaven ..., keinem Manne untertan“ – Aischylos) gegenüber dem Despotismus der Perser heraus. In Bezug der griechischen Geisteswelt zu fremden und orientalischen Kulturen hielten bereits in der Antike alle Spielarten späterer Diskurse ihre Parade, von monokulturellem Chauvinismus über transkulturellen Kosmopolitismus bis zur Idealisierung von sittenstrengen Barbaren wie Skythen und Thrakern als Kritik eigener Dekadenz. Es lässt sich zudem kein dem Athener Chauvinismus gegenüber kritischerer und kulturell empathischerer Geist vorstellen als der Reiseschriftsteller Herodot, selbst Spross einer kleinasiatischen Mischkultur aus Karern und ionischen Griechen. Der neuzeitlichen Vereinnahmung des Griechentums als säkularen Identitätsfundaments des modernen Westens und als erster europäischer Zivilisation konterte der Historiker Martin Bernal mit seinem provokanten Buch Black Athena. Darin rekonstruierte er mit teils spekulativen Thesen die griechische Antike als zutiefst orientalische Kultur mit interkulturellen Verbindungen nach Asien und Afrika. Doch gestand Bernal den mythischen Genealogien nicht nur faktische Evidenz zu, sondern reproduzierte er den neuzeitlichen Antagonismus von Okzident und Orient durch übertriebene Orientalisierung der Griechen.
Der europäischen Furcht vor der militärischen Expansion islamischer Invasoren, im Frühmittelalter über die iberische Halbinsel, im Spätmittelalter über Osteuropa, gestand sogar Said Berechtigung zu. Die Raubzüge nordafrikanischer Piraten (Berberesken) bis weit ins 17. Jahrhundert und bis zur irischen Südküste zur Akquisition weißer Sklaven waren aber mitnichten Erfindung antiislamischer Propaganda, sondern erlittene Wirklichkeit. Das Corpus Christianum und die islamische Umma bildeten stabile identitätsstiftende Antagonismen. In der Praxis wurde diese Feindschaft bei jeder sich bietenden Gelegenheit unterlaufen. Nicht nur durch die interkulturelle Hofhaltung des orientophilen Stauferkaisers Frederico II., nicht nur durch die gemeinsame Rezeption antiker Texte durch muslimische, christliche und jüdische Intellektuelle in Sevilla, Cordoba, Grenada und Salerno, nicht nur durch die Kooperationen des französischen Königs François I. und der Tudorkönigin Elizabeth I. mit den Osmanen, nicht nur durch den regen transadriatischen Handel des Kirchenstaates mit ihnen, der durch Venezianer und dalmatinische Piraten (Uskoken) unter dem Banner des Kreuzzugsgedankens gestört wurde, sondern das gesamte Mediterrané bringt in seiner mannigfaltigen wechselseitigen kulturellen und ökonomischen Durchdringung als schillernde Grauzone jeglichen Antagonismus zwischen christlichem Abendland und muslimischem Morgenland wie ein Kartenhaus zu Fall. Die Händlerrepublik Amalfi übernahm von den Muslimen nicht nur die Architektur, sondern auch Transportaufträge. Von Byzanz gar nicht zu sprechen, das sich nicht nur posthum der Scheidung in Orient und Okzident entzieht, sondern seit dem Kirchenschisma stets eine größere kulturelle Nähe zu den muslimischen Gegnern oder Verbündeten verspürte als zu den westlichen Vertretern der lateinischen Kirche. Kraftvoll bäumte sich diese Solidarität auf, als die Einwohner Konstantinopels während des Dritten Kreuzzugs 1189 ihre muslimischen Mitbürger vor einem mordenden und plündernden Mob aus Pisanern, Venezianern und Flamen schützten.
Metaphysik der Opferrolle
Man muss kein Historiker, keine Historikerin sein, um zu erkennen, dass Saids Behauptung, der französische und englische Imperialismus datiere, vor allem in den Regionen des Nahen Ostens, auf das 17. Jahrhundert zurück, planer Nonsens ist. Dass ein Großteil Nordafrikas und des Vorderen Orients in dieser Epoche Domäne des militärisch noch immer expansiven Osmanischen Reichs war, passte nicht in sein Konzept quasi naturhafter europäischer Suprematie und wurde unter seinen Orientalismusteppich gekehrt. Doch beginnt der Imperialismus für Said bekanntlich schon bei der Reiseliteratur. So man aktuelle Rassismen gegenüber muslimischen und nichtmuslimischen Migranten, historische christliche Islamfeindlichkeit, säkulare westliche Wissenschaft und koloniale Landnahmen als Bestandteile eines kohärenten Systems auffasst, wird der Manichäismus von europäischem Täter und orientalischem Opfer bis in unerdenkliche Zeiten zurück in die Subjekte eingefräst. Der christliche Bauer, der als Opfer der osmanischen Landnahme die »muselmanischen Teufel« verflucht, ist folglich Ahnherr eines »antimuslimischen Rassismus«, während Diskriminierung der »Ungläubigen« von muslimischer Seite in dieser konzertierten kognitiven Verzerrung irgendwie als antikolonialer Widerstand durchgeht. Eine der kraftvollen Stimmen einer orientalischen Sicht war der Reiseschriftsteller Evlyia Çelebi. 17 Jahre bevor die osmanische Armee versuchte, sich Wien einzuverleiben, bereiste er die Habsburger Reichshauptstadt und hinterließ ein wenig schmeichelhaftes Porträt des Kaiser Leopold I.: »Seine Lippen sind wulstig wie die eines Kamels, und in seinen Mund würde ein ganzer Laib Brot auf einmal passen. Auch seine Zähne sind groß und weiß wie die eines Kamels. Immer wenn er spricht, spritzt und trieft ihm der Speichel aus seinem Mund und von seinen Kamellippen, als ob er erbrechen würde.« Aus eigener Erfahrung weiß ich, welches Vergnügen solche Worte dem Kritiker der eigenen Kultur bereiten können. Nicht nur lassen sich damit antihabsburgische Sentiments munitionieren, man kann auch mit ausreichendem Mangel an historischer Differenzierungsgabe schön ein Statement der kolonial Abgewerteten gegen ihre ewigen Abwerter hineinfantasieren. Doch sie sind nicht Ausdruck des Aufbegehrens eines kolonialisierten Objekts, sondern eines Kolonisators. Man stelle sich vor, ein westlicher Autor hätte ähnliche Worte für die Physiognomie des Sultans gefunden.
Die Auseinandersetzung englischer und französischer Gelehrter mit dem Islam und dem Orient erwies sich in dieser Periode hingegen als erstaunlich differenziert. Der britische Historiker Noel Malcolm legte mit seinem Buch Useful Enemies. Islam and The Orient in Western Political Thought 1450–1750 ein Werk vor, das es gar nicht nötig hat, gegen Said zu polemisieren, weil er ihn nüchtern per Quellenanalyse korrigiert. Eine positive Bezugnahme zum Islam nimmt zur Zeit der blutigen Religionskriege zu, Katholiken und Protestanten instrumentalisieren den Islam für ihre Kritik der jeweils gegnerischen christlichen Bekenntnisform. Der Thomas Hobbes nahestehende Gelehrte Henry Stubbes etwa so wie später die Unitarier Charles Blunt und Arthur Bury revidieren negative Islambilder und manche, wie der irische Freidenker und Pantheist John Tormand, wagen erste Vorstöße einer Säkularisierung und Religionskritik, indem sie gegen die seit dem Mittelalter vorherrschende Erzählung von Mohammed als Betrüger und politischem Taschenspieler polemisieren, mit der Relativierung, dass Christen- und Judentum nicht weniger Betrug
betrieben als der Islam.
Die in jeder Hinsicht bemerkenswerte Mary Montagu,4 Verfasserin der Briefe aus dem Orient und eines der größten Vorbilder Lord Byrons, findet in Saids Buch keine Erwähnung, was nicht verwundert, nimmt sie doch als Kennerin der osmanischen Gesellschaft etliche Punkte seiner Orientalismuskritik vorweg. Als Gattin des britischen Botschafters in Istanbul ab 1716 prahlt sie damit, kraft ihrer intimen Kenntnisse die gesamte Fach- und Reiseliteratur über das Osmanische Reich ihrer ethnozentrischen Verzerrungen überführen zu können. Ihre günstige Schilderung der Stellung der osmanischen Frau ist freilich dem Umstand geschuldet, dass sie hauptsächlich in höchsten Kreisen verkehrt, und das zu einer Zeit, als sich die Geschlechterverhältnisse am Sultanshof temporär lockern. Montagus Affirmation der osmanischen Sklavenhaltung spiegelt ihr aristokratisches Herrschaftsethos wider, ihr gesamter Kulturre-lativismus ist Ausdruck eines zumal erfrischenden Ehrgeizes der Provokation gängiger Orientbilder.
Obgleich Said auf der einschrötigen Grundthese beharrte, Orientalismus speise sich prinzipiell aus Chauvinismus und Abwertung des Orients, sind ihm die unzähligen Tendenzen westlicher Idealisierung nicht entgangen. Völlig richtig erkannte er auch darin Formen epistemischer Beherrschung, welche den und das Fremde nur aufwertet, so er es und ihn den eigenen projektiven Wunschbildern unterwirft. Genau hier erst hätte es interessant werden können – und sich eine bunte Typologie westlichen Kulturrelativismus und seiner Interessen entwerfen lassen. Was unweigerlich zu der Erkenntnis geführt hätte, dass die vielfältigen Spielarten von Exotismus, kultureller Empathie und Parteinahme für fremde Kulturen, welche die abendländische Geistesgeschichte ebenso prägten wie die Diskurse der Suprematie, selbst als Ablehnung von europäischem Chauvinismus oder als Zivilisationskritik nicht davor gefeit waren, dem Imperialismus den Weg zu ebnen. Zu so viel Dialektik reichte es weder bei Said noch seinen Schülern hin. Der eigene stereotype Orient-Okzident-Antagonismus versperrt solch einer Denkbewegung den Weg, ebenso wie der Einsicht, dass diese Kritik den Orient, den sie ermächtigen und vor dem Orientalismus schützen will, selbst verdinglicht. Sie verkam zum Tagwerk von Islamisten, Nationalisten und einigen akademischen Paradigmenwechselgewinnlern. Kulturalisierte Spiegelfechtereien, die an den wirklichen Problemen der »Verdammten der Erde« wohl ebenso vorbeigehen wie diesen selbst am Arsch.